Don Winslow, Das Kartell
 Im perfekten Roman ist die dargestellte Fiktion so wirklich, dass man damit in der Wirklichkeit etwas anfangen kann, auch wenn es keine Hilfestellung dafür gibt.
Im perfekten Roman ist die dargestellte Fiktion so wirklich, dass man damit in der Wirklichkeit etwas anfangen kann, auch wenn es keine Hilfestellung dafür gibt.
Don Winslows „Kartell“ ist natürlich ein Thriller, was die äußere Aufmachung und das Marketing betrifft, in seinem Kern ist der Roman aber ein Stück von der Hinterseite jener Währung, die uns im scheinbar fernen Europa als goldenes US-Wesen dargeboten wird. Im Gewusel aus hunderten Plots geht es um Krieg, feindliche Übernahmen, Scheinfirmen, Korruption und Gewalt. Die Schauplätze liegen zwar meist in einem Mexikanischen Bundesstaat, gesteuert wird das Ganze freilich direkt aus Washington heraus. Und wenn Mexiko für die Kriege zu klein wird, weicht man stracks in südliche Guatemala aus.

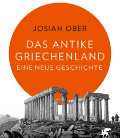 „Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte galten Demokratie und Wachstum allerdings nicht als normal; sie waren nicht einmal vorstellbar. Lediglich im ersten Jahrtausend v. Chr. gab es im antiken Griechenland einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, in denen Demokratie und Wachstum für die Bürger im klassischen Griechenland tatsächlich normal waren. Wie es dazu kam und warum das Wissen um diesen Umstand wichtig ist, führe ich in dem vorliegenden Buch aus.“ (9)
„Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte galten Demokratie und Wachstum allerdings nicht als normal; sie waren nicht einmal vorstellbar. Lediglich im ersten Jahrtausend v. Chr. gab es im antiken Griechenland einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, in denen Demokratie und Wachstum für die Bürger im klassischen Griechenland tatsächlich normal waren. Wie es dazu kam und warum das Wissen um diesen Umstand wichtig ist, führe ich in dem vorliegenden Buch aus.“ (9) Manche Bücher bleiben als Manifeste in Erinnerung, da ist der Inhalt des Buches schon lange vergessen. Bertha von Suttners „Die Waffen nieder“ (1889) ist so ein Buch, das wahrscheinlich seit hundert Jahren nicht mehr gelesen aber umso häufiger zitiert worden ist.
Manche Bücher bleiben als Manifeste in Erinnerung, da ist der Inhalt des Buches schon lange vergessen. Bertha von Suttners „Die Waffen nieder“ (1889) ist so ein Buch, das wahrscheinlich seit hundert Jahren nicht mehr gelesen aber umso häufiger zitiert worden ist. Süffisant verweisen Patrioten darauf, dass es in Tirol kaum Boulevard-Journalismus gibt, weil in diesem Land nur hochqualifizierte Journalisten in hochqualifizierten Medien für ein hochqualifiziertes Publikum schreiben.
Süffisant verweisen Patrioten darauf, dass es in Tirol kaum Boulevard-Journalismus gibt, weil in diesem Land nur hochqualifizierte Journalisten in hochqualifizierten Medien für ein hochqualifiziertes Publikum schreiben.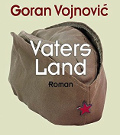 Nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens haben die meisten in Europa gestaunt, wie viele Nationalitäten und Staaten in diesem wundersamen Tito-Staat versteckt gewesen sind. Aber auch die ehemaligen Bewohner sind über Nacht in einen anderen Staatszustand versetzt worden, in dem sie sich immer noch mit ihren Geschichten einrichten müssen.
Nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens haben die meisten in Europa gestaunt, wie viele Nationalitäten und Staaten in diesem wundersamen Tito-Staat versteckt gewesen sind. Aber auch die ehemaligen Bewohner sind über Nacht in einen anderen Staatszustand versetzt worden, in dem sie sich immer noch mit ihren Geschichten einrichten müssen. In der guten Lyrik ist nicht nur die Schwerkraft als solche aufgehoben, im lyrischen Kraftfeld verlieren die Wörter oft auch ihre ursprüngliche Bedeutung und legen sich neue semantische Flügel zu.
In der guten Lyrik ist nicht nur die Schwerkraft als solche aufgehoben, im lyrischen Kraftfeld verlieren die Wörter oft auch ihre ursprüngliche Bedeutung und legen sich neue semantische Flügel zu.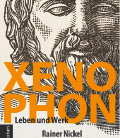 „Die vorliegende Darstellung möchte dazu beitragen, Xenophons Persönlichkeit zu verstehen und dabei nicht nur seinen Lebenslauf, seine kulturelle Umwelt, seine literarischen Voraussetzungen und Absichten und seine spezifischen Arbeitstechniken, sondern auch seine politischen Anschauungen und Überzeugungen kennenzulernen.“ (4)
„Die vorliegende Darstellung möchte dazu beitragen, Xenophons Persönlichkeit zu verstehen und dabei nicht nur seinen Lebenslauf, seine kulturelle Umwelt, seine literarischen Voraussetzungen und Absichten und seine spezifischen Arbeitstechniken, sondern auch seine politischen Anschauungen und Überzeugungen kennenzulernen.“ (4) Gute Denkmäler müssen immer wieder nachjustiert und umgebaut werden, sonst geht ihnen der Diskussionssinn verloren und sie werden zu Archivmaterial.
Gute Denkmäler müssen immer wieder nachjustiert und umgebaut werden, sonst geht ihnen der Diskussionssinn verloren und sie werden zu Archivmaterial.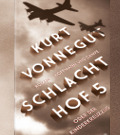 „Ist der Roman gegen Krieg? - Warum nicht gegen Gletscher?“ Gute Romane stellen die entscheidenden Fragen zeitlos wie eben philosophische Grundhandgriffe wirken.
„Ist der Roman gegen Krieg? - Warum nicht gegen Gletscher?“ Gute Romane stellen die entscheidenden Fragen zeitlos wie eben philosophische Grundhandgriffe wirken. „Warum also ein Buch, das sich mit jenem Glauben befasst – dem Monotheismus –, dessen Gott dem Machtkalkül einer priesterlichen Verfassergruppe entsprungen scheint, deren Wahrheitsbedürfnis weit hinter ihrer Machtgier zurückstand?“ (12)
„Warum also ein Buch, das sich mit jenem Glauben befasst – dem Monotheismus –, dessen Gott dem Machtkalkül einer priesterlichen Verfassergruppe entsprungen scheint, deren Wahrheitsbedürfnis weit hinter ihrer Machtgier zurückstand?“ (12)