Kirstin Breitenfellner, Gedichte ohne ich
 Üblicherweise entstehen Gedichte rund um das lyrische Ich herum. Was aber nun, wenn dieses Ich sich aus dem Rennen nimmt, verschüttet wird oder sonst wie verlorengeht? Und was lässt sich über das lyrische Vakuum sagen, das bei Gedichten „ohne ich“ entsteht?
Üblicherweise entstehen Gedichte rund um das lyrische Ich herum. Was aber nun, wenn dieses Ich sich aus dem Rennen nimmt, verschüttet wird oder sonst wie verlorengeht? Und was lässt sich über das lyrische Vakuum sagen, das bei Gedichten „ohne ich“ entsteht?
Kirstin Breitenfellner arrangiert in zehn Kapiteln diverse lyrische Versuchsanordnungen, um der „Ich-Entnahme“ im poetischen Kontext auf die Schliche zu kommen. Dabei wird die bewährte Form des Sonetts gewählt, sie dient als verlässliches Gefäß für diverse lyrische Reaktionen und Eruptionen.
In der Eingangssequenz werden daher dem Ich noch einmal allerhand Kräfte, Ambitionen und Reflexionen zugesprochen. In der ersten Strophe kommt dem Ich die Kompetenz zu, die Welt zu erschaffen.

 „Doch was Seneca verabscheute, bewunderte er gleichzeitig. Seine Verachtung für die Macht hielt ihn nicht davon ab, von ihr zu profitieren. Die Dunkelheit Roms glänzte golden. Zweitausend Jahre später können wir auch im Rückblick auf Augustus und seine Erben in dieser Mischung aus Tyrannei und Triumph, Sadismus und Glamour, Machtgier und Ruhm eine goldene Leuchtkraft wahrnehmen, die keine Dynastie seither mehr erreicht hat.“ (S. 21)
„Doch was Seneca verabscheute, bewunderte er gleichzeitig. Seine Verachtung für die Macht hielt ihn nicht davon ab, von ihr zu profitieren. Die Dunkelheit Roms glänzte golden. Zweitausend Jahre später können wir auch im Rückblick auf Augustus und seine Erben in dieser Mischung aus Tyrannei und Triumph, Sadismus und Glamour, Machtgier und Ruhm eine goldene Leuchtkraft wahrnehmen, die keine Dynastie seither mehr erreicht hat.“ (S. 21)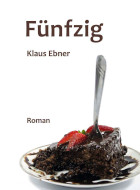 Am Morgen wacht der Erzähler auf wie der Käfer in der Verwandlung von Franz Kafka und stellt fest, dass sein Körper fünfzig Jahresringe hat. Heute sollen Geburtstagsfeiern losgehen, aber der Held ist wie gelähmt von seinem eigenen Leben und bleibt regungslos liegen, während sein Gehirn fünfzig Jahre abarbeitet. Klaus Ebner findet einen makabren Zugang, ein halbes Jahrhundert „Eigenleben“ als historisches Gesellschaftsgemälde gespiegelt im kleinen Einzelkopf originär darzustellen.
Am Morgen wacht der Erzähler auf wie der Käfer in der Verwandlung von Franz Kafka und stellt fest, dass sein Körper fünfzig Jahresringe hat. Heute sollen Geburtstagsfeiern losgehen, aber der Held ist wie gelähmt von seinem eigenen Leben und bleibt regungslos liegen, während sein Gehirn fünfzig Jahre abarbeitet. Klaus Ebner findet einen makabren Zugang, ein halbes Jahrhundert „Eigenleben“ als historisches Gesellschaftsgemälde gespiegelt im kleinen Einzelkopf originär darzustellen.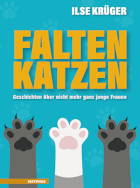 In der Nacht sind alle Katzen grau, und auch ihre Falten sieht man nicht. Ilse Krüger ist eine Meisterin der Ironie, wenn sie plumpe Sprichwörter, verrutschte Selfies, und falsche Binsenweisheiten durch die Lebensrealität zurechtrückt. Ihre Heldinnen kämpfen mit Vorurteilen und falschen Prophezeiungen, die über sie im Umlauf sind. Oft sind natürlich die Männer der Grund für den Dissens zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber bei genauerem Hinhören stellt sich bei Männern und Frauen eine ähnliche Unwucht heraus, die ihre Bilder zum Trudeln bringen.
In der Nacht sind alle Katzen grau, und auch ihre Falten sieht man nicht. Ilse Krüger ist eine Meisterin der Ironie, wenn sie plumpe Sprichwörter, verrutschte Selfies, und falsche Binsenweisheiten durch die Lebensrealität zurechtrückt. Ihre Heldinnen kämpfen mit Vorurteilen und falschen Prophezeiungen, die über sie im Umlauf sind. Oft sind natürlich die Männer der Grund für den Dissens zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber bei genauerem Hinhören stellt sich bei Männern und Frauen eine ähnliche Unwucht heraus, die ihre Bilder zum Trudeln bringen.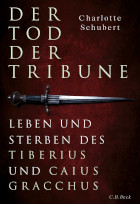 Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches.
Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches. Manchmal lässt es das literarische Glück zu, dass sich ein ganzes Land über jene Literatur freuen darf, die es mit einem Stipendium angeregt hat. Isabella Krainer hätte auch ohne Großes Tiroler Literaturstipendium den wundersamen Gedichtband „Heul doch!“ geschaffen, durch die offizielle Auslobung für 2023/24 fieberte eine kleine literarische Schar freilich dem Band entgegen, der in einem Tiroler Verlag erscheinen durfte.
Manchmal lässt es das literarische Glück zu, dass sich ein ganzes Land über jene Literatur freuen darf, die es mit einem Stipendium angeregt hat. Isabella Krainer hätte auch ohne Großes Tiroler Literaturstipendium den wundersamen Gedichtband „Heul doch!“ geschaffen, durch die offizielle Auslobung für 2023/24 fieberte eine kleine literarische Schar freilich dem Band entgegen, der in einem Tiroler Verlag erscheinen durfte.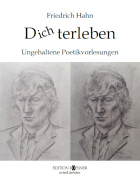 Poetikvorlesungen gelten gemeinhin als sozial hochrangige Veranstaltungen, in denen das dichtende Individuum einem akademischen Publikum die eigene Schreibtheorie anhand des eigenen Werkes vorträgt. Das Genre erweist sich als Kippmedium zwischen wissenschaftlicher Analyse und subjektiver Fiktion. Der Begriff wurde ursprünglich aus bilanztechnischen Gründen verwendet, mit dieser Bezeichnung nämlich lässt sich eine Veranstaltung im universitären Betrieb unkompliziert abrechnen.
Poetikvorlesungen gelten gemeinhin als sozial hochrangige Veranstaltungen, in denen das dichtende Individuum einem akademischen Publikum die eigene Schreibtheorie anhand des eigenen Werkes vorträgt. Das Genre erweist sich als Kippmedium zwischen wissenschaftlicher Analyse und subjektiver Fiktion. Der Begriff wurde ursprünglich aus bilanztechnischen Gründen verwendet, mit dieser Bezeichnung nämlich lässt sich eine Veranstaltung im universitären Betrieb unkompliziert abrechnen.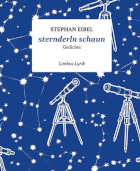 „olle san in ihrn hirn alan“ (49) – Gedichte sind wahrscheinlich ein Überdruckventil, um den Dampf der Solitude ein wenig abzulassen.
„olle san in ihrn hirn alan“ (49) – Gedichte sind wahrscheinlich ein Überdruckventil, um den Dampf der Solitude ein wenig abzulassen.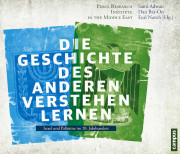 „Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, israelische und palästinensische Schulkinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an die historischen Narrative des 20. Jahrhunderts der jeweils anderen Seite heranzuführen, denn diese lesen sie nicht in ihren Schulbüchern. Es soll den Kindern helfen, ihr Wissen über die offiziellen Versionen und Narrative der jeweiligen Seite hinaus zu erweitern. Es soll Geschichte aus einer vielseitigen Perspektive lehren, anstatt die Kinder weiter mit einseitigen Darstellungen zu indoktrinieren, und schließlich soll es Lehrer darin ausbilden, Geschichte/n aus der Sicht mehrerer Perspektiven zu lehren.“
„Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, israelische und palästinensische Schulkinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an die historischen Narrative des 20. Jahrhunderts der jeweils anderen Seite heranzuführen, denn diese lesen sie nicht in ihren Schulbüchern. Es soll den Kindern helfen, ihr Wissen über die offiziellen Versionen und Narrative der jeweiligen Seite hinaus zu erweitern. Es soll Geschichte aus einer vielseitigen Perspektive lehren, anstatt die Kinder weiter mit einseitigen Darstellungen zu indoktrinieren, und schließlich soll es Lehrer darin ausbilden, Geschichte/n aus der Sicht mehrerer Perspektiven zu lehren.“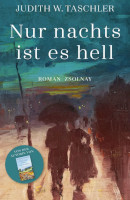 „Geschichte erzählt als Gutenachtgeschichte für Erwachsene“ – mit dieser frischen Leseempfehlung ermuntern einander die Fans von Judith Taschler, ihre neue Familiensaga zu lesen.
„Geschichte erzählt als Gutenachtgeschichte für Erwachsene“ – mit dieser frischen Leseempfehlung ermuntern einander die Fans von Judith Taschler, ihre neue Familiensaga zu lesen.