Stefan Rebenich, Die Deutschen und ihre Antike
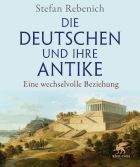 „Gegenstand der Darstellung sind die vielfältigen Beziehungen zwischen der griechisch-römischen Antike und der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Dieses Altertum galt als »klassisch«, weil seit dem Renaissance-Humanismus ihre als Einheit verstandene Kultur als normativ wahrgenommen wurde. Griechische und römische Autoren bildeten einen Kanon von auctores classici, die in den höheren Schulen gelesen und auf Grund ihrer sprachlichen, stilistischen und ästhetischen Qualitäten als mustergültig angesehen wurden.“ (S. 12)
„Gegenstand der Darstellung sind die vielfältigen Beziehungen zwischen der griechisch-römischen Antike und der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Dieses Altertum galt als »klassisch«, weil seit dem Renaissance-Humanismus ihre als Einheit verstandene Kultur als normativ wahrgenommen wurde. Griechische und römische Autoren bildeten einen Kanon von auctores classici, die in den höheren Schulen gelesen und auf Grund ihrer sprachlichen, stilistischen und ästhetischen Qualitäten als mustergültig angesehen wurden.“ (S. 12)
„Die Deutschen und ihre Antike“ erzählt die wechselvolle Beziehung zwischen der deutschen Geschichtswissenschaft und Pädagogik im 19. und 20. Jahrhundert und der Welt der Antike, der ganz besonders im Bildungshorizont des Bürgertums eine hervorgehobene Stellung zugewiesen worden ist.

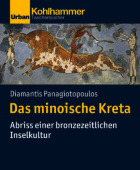 „Kreta, am Südostende Europas gelegen, war die Wiege einer antiken Hochkultur, die den unvoreingenommenen Betrachter mit Staunen erfüllt. Auf der gebirgigen Insel entwickelte sich eine bronzezeitliche Gesellschaft, die auf den ersten Blick ganz anders erscheint als ihre zeitgleichen Kulturen in Ägypten und dem Vorderen Orient.“ (S. 11)
„Kreta, am Südostende Europas gelegen, war die Wiege einer antiken Hochkultur, die den unvoreingenommenen Betrachter mit Staunen erfüllt. Auf der gebirgigen Insel entwickelte sich eine bronzezeitliche Gesellschaft, die auf den ersten Blick ganz anders erscheint als ihre zeitgleichen Kulturen in Ägypten und dem Vorderen Orient.“ (S. 11) Was für ein universell gekreuzter Begriff! Die Fossilien liegen in ferner Vergangenheit und vom Futur wissen wir nicht, wie lange es hält.
Was für ein universell gekreuzter Begriff! Die Fossilien liegen in ferner Vergangenheit und vom Futur wissen wir nicht, wie lange es hält.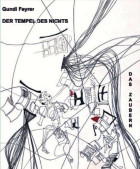 Wenn Materie nicht aus Materie besteht, wie in Physikerkreisen formuliert wird, dann könnte vielleicht Dichtung Materie sein?
Wenn Materie nicht aus Materie besteht, wie in Physikerkreisen formuliert wird, dann könnte vielleicht Dichtung Materie sein?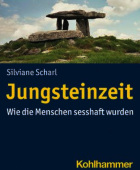 „Die Jungsteinzeit (Neolithikum, älteste Daten aus Südosteuropa im 7. Jahrtausend v. Chr.) ist die Epoche der europäischen Prähistorie, in der die Menschen sesshaft werden und beginnen, Landwirtschaft zu betreiben.“ (S. 7)
„Die Jungsteinzeit (Neolithikum, älteste Daten aus Südosteuropa im 7. Jahrtausend v. Chr.) ist die Epoche der europäischen Prähistorie, in der die Menschen sesshaft werden und beginnen, Landwirtschaft zu betreiben.“ (S. 7)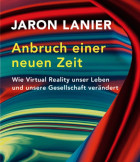 „Unser Gehirn ist nicht in Stein gemeißelt.“ (77) So ein Satz verändert nicht nur die gesamte Weltlage des Denkens, sondern weist darauf hin, dass es in der Kunst tatsächlich immer Überraschungen und Weiterentwicklungen gibt.
„Unser Gehirn ist nicht in Stein gemeißelt.“ (77) So ein Satz verändert nicht nur die gesamte Weltlage des Denkens, sondern weist darauf hin, dass es in der Kunst tatsächlich immer Überraschungen und Weiterentwicklungen gibt.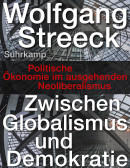 „Dieses Buch steht, wie vieles, was heute geschrieben wird, in der Tradition Karl Polanyis. Gegenstand jeder politischen Ökonomie in seiner Nachfolge, theoretisch wie praktisch, ist die gesellschaftliche Einbettung der unter dem Liberalismus losgelassenen kapitalistischen Ökonomie – die Sozialisierung der Ökonomie zur Verhinderung der Verwirtschaftung der Gesellschaft. Einbettung heißt Rückgewinnung gesellschaftlicher Kontrolle über den Selbstlauf selbstregulierender Märkte.“ (S. 9)
„Dieses Buch steht, wie vieles, was heute geschrieben wird, in der Tradition Karl Polanyis. Gegenstand jeder politischen Ökonomie in seiner Nachfolge, theoretisch wie praktisch, ist die gesellschaftliche Einbettung der unter dem Liberalismus losgelassenen kapitalistischen Ökonomie – die Sozialisierung der Ökonomie zur Verhinderung der Verwirtschaftung der Gesellschaft. Einbettung heißt Rückgewinnung gesellschaftlicher Kontrolle über den Selbstlauf selbstregulierender Märkte.“ (S. 9)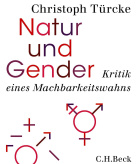 „Die Natur ist das, was wir aus ihr machen. Aber ist sie nur das – und sonst nichts? Erst diese Frage rührt an den Nerv des Problems. Wer sie munter bejaht, mag sich auf dem Weg zur Emanzipation von allen Naturschranken wähnen. Faktisch befindet er sich am Übergang von der Realitätstüchtigkeit zum Machbarkeits-, um nicht zu sagen, zum Schöpfungswahn. Wie sehr die aktuellen sozialen Kräfteverhältnisse diesen Wahn fördern: Darum geht es auf den folgenden Seiten.“ (S. 11)
„Die Natur ist das, was wir aus ihr machen. Aber ist sie nur das – und sonst nichts? Erst diese Frage rührt an den Nerv des Problems. Wer sie munter bejaht, mag sich auf dem Weg zur Emanzipation von allen Naturschranken wähnen. Faktisch befindet er sich am Übergang von der Realitätstüchtigkeit zum Machbarkeits-, um nicht zu sagen, zum Schöpfungswahn. Wie sehr die aktuellen sozialen Kräfteverhältnisse diesen Wahn fördern: Darum geht es auf den folgenden Seiten.“ (S. 11) „Im Laufe der vergangenen etwa 50 Jahre haben »neue« Ideen, wie wir uns verhalten sollten, unser Denken korrumpiert. Inzwischen sehen wir Schwarz als Weiß an, Schlechtes als Gutes: Es ist moralisch unmoralisch zu sein. Dieser Wandel hat enorme Auswirkungen, wurde jedoch durch viele kleine, kaum erkennbare Schritte erreicht.“ (S. 9)
„Im Laufe der vergangenen etwa 50 Jahre haben »neue« Ideen, wie wir uns verhalten sollten, unser Denken korrumpiert. Inzwischen sehen wir Schwarz als Weiß an, Schlechtes als Gutes: Es ist moralisch unmoralisch zu sein. Dieser Wandel hat enorme Auswirkungen, wurde jedoch durch viele kleine, kaum erkennbare Schritte erreicht.“ (S. 9) „Der Atlas der Weltwirtschaft liefert ein Gesamtbild, das starke Hinweise darauf enthält, was in der Weltwirtschaft schiefläuft und was die Staatengemeinschaft dagegen tun sollte.“ (S. 1)
„Der Atlas der Weltwirtschaft liefert ein Gesamtbild, das starke Hinweise darauf enthält, was in der Weltwirtschaft schiefläuft und was die Staatengemeinschaft dagegen tun sollte.“ (S. 1)