Albert Ennemoser, Geschichten und Bilder
 Im Zeitalter der Digitalisierung ist es vielleicht die Hauptaufgabe eines Buches, haptisch unterwegs zu sein. Viele Sinneseindrücke lassen sich digital erregen, das taktile Aufschreien der Sensoren freilich, wenn Kunst auf den Körper trifft, lässt sich nur haptisch analog produzieren.
Im Zeitalter der Digitalisierung ist es vielleicht die Hauptaufgabe eines Buches, haptisch unterwegs zu sein. Viele Sinneseindrücke lassen sich digital erregen, das taktile Aufschreien der Sensoren freilich, wenn Kunst auf den Körper trifft, lässt sich nur haptisch analog produzieren.
Albert Ennemoser ist in mehreren Genres und Künsten unterwegs. Seine „Geschichten und Bilder“ sind als eine Art Anleitung zum Gesamtwerk zu lesen. Aus diesem Grund erscheint das Buch mit zwei Bildern als Vorder- und Hintercover, die buchrelevanten Angaben nach Verlag, Autor und Titel sind auf den Buchrücken verschoben, wo sie letztlich den größten Nutzen entfalten, denn vom Buch sieht man meist nur das Rückgrat.

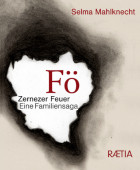 Heimat kann eine Silbe sein, ein Wort, ein Ausruf, ein Seufzer!
Heimat kann eine Silbe sein, ein Wort, ein Ausruf, ein Seufzer!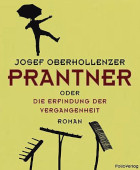 Die meisten Bücher rennen einem nach, überfallen einen und man kommt mit der Abwehr der Massenware des Literaturbetriebes nicht nach. In seltenen Fällen lassen sich Bücher ausmachen, denen man als Leser selbst nachgehen muss, sie sind verschlüsselt, geheimnisvoll und einmalig. Sie lassen sich erst lesen, wenn man zuvor Freundschaft mit dem Autor und seinem Konzept geschlossen hat.
Die meisten Bücher rennen einem nach, überfallen einen und man kommt mit der Abwehr der Massenware des Literaturbetriebes nicht nach. In seltenen Fällen lassen sich Bücher ausmachen, denen man als Leser selbst nachgehen muss, sie sind verschlüsselt, geheimnisvoll und einmalig. Sie lassen sich erst lesen, wenn man zuvor Freundschaft mit dem Autor und seinem Konzept geschlossen hat. Bücherfreunde wissen: Die Steigerung von Buch heißt Umkehrbuch. Das ist eine Art U-Turn, wie man ihn im Rallye-Sport kennt. Man hält das Buch wie immer, macht einen U-Turn, und hat plötzlich ein anderes Buch in der Hand. Die erste Frage bei der Lektüre eines Split-Buches lautet folglich: Was lese ich zuerst? Lese ich in einem Zug bis zur Mitte, oder wechsle ich nach jedem Gedicht die Buchhälfte?
Bücherfreunde wissen: Die Steigerung von Buch heißt Umkehrbuch. Das ist eine Art U-Turn, wie man ihn im Rallye-Sport kennt. Man hält das Buch wie immer, macht einen U-Turn, und hat plötzlich ein anderes Buch in der Hand. Die erste Frage bei der Lektüre eines Split-Buches lautet folglich: Was lese ich zuerst? Lese ich in einem Zug bis zur Mitte, oder wechsle ich nach jedem Gedicht die Buchhälfte?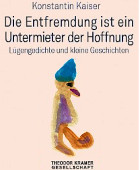 Titel sagen mittlerweile weniger darüber aus, was in einem Buch drinsteht, als vielmehr was der Leserschaft zugemutet wird.
Titel sagen mittlerweile weniger darüber aus, was in einem Buch drinsteht, als vielmehr was der Leserschaft zugemutet wird.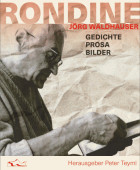 Vor Jahrzehnten, als die Heranwachsenden noch hirnlos in den Tag hineinstudiern konnten und anschließend einen Job ins Maul geflogen bekamen, machte in Tirol ein seltsames Gerücht die Runde: In Hall sitzt in der Nudelfabrik während der Nacht ein Philosoph an der Pforte und sinniert während seiner Aufsicht über den Sinn der Welt nach.
Vor Jahrzehnten, als die Heranwachsenden noch hirnlos in den Tag hineinstudiern konnten und anschließend einen Job ins Maul geflogen bekamen, machte in Tirol ein seltsames Gerücht die Runde: In Hall sitzt in der Nudelfabrik während der Nacht ein Philosoph an der Pforte und sinniert während seiner Aufsicht über den Sinn der Welt nach.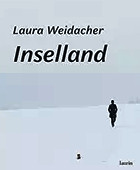 Was für eine Verheißung! Inselland – ein doppeltes Glücksversprechen, wenn die lyrische Seele sich auf eine Insel zurückzieht und gleichzeitig über weites Land schwebt.
Was für eine Verheißung! Inselland – ein doppeltes Glücksversprechen, wenn die lyrische Seele sich auf eine Insel zurückzieht und gleichzeitig über weites Land schwebt. Eine Liebesgeschichte überlebt die ausgelösten Emotionen nur, wenn sie sich rechtzeitig auf die rettende Liebesinsel „Ironie“ rettet. Und einmal dort gelandet, lässt sich neben der Liebe auch gleich der Tod wunderbar leicht erzählen.
Eine Liebesgeschichte überlebt die ausgelösten Emotionen nur, wenn sie sich rechtzeitig auf die rettende Liebesinsel „Ironie“ rettet. Und einmal dort gelandet, lässt sich neben der Liebe auch gleich der Tod wunderbar leicht erzählen.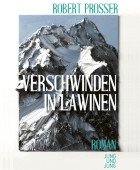 Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus davon abhängig, dass er auch von jenen mitgetragen wird, die ihm am liebsten aus dem Weg gehen. Ähnlich dem Sozialismus in der DDR ist der Tourismus in den Alpen eine Lebensform, die mit „IM“s im Dorfleben überwacht und eingefordert wird.
Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus davon abhängig, dass er auch von jenen mitgetragen wird, die ihm am liebsten aus dem Weg gehen. Ähnlich dem Sozialismus in der DDR ist der Tourismus in den Alpen eine Lebensform, die mit „IM“s im Dorfleben überwacht und eingefordert wird. Der wissenschaftlichste Witz aller Zeiten geht in etwa so: Ein Witz kommt auf die Bühne und erklärt, dass er ein Witz sei.
Der wissenschaftlichste Witz aller Zeiten geht in etwa so: Ein Witz kommt auf die Bühne und erklärt, dass er ein Witz sei.