Florian Kronbichler, Die Kunst, von oben zu leben
 Die meisten Zeitgenossen nehmen Südtirol als Durchreisende am Talboden oder auf Hangautobahnen wahr, sie würden ordentlich staunen, stiegen sie kurz aus und schauten nach oben.
Die meisten Zeitgenossen nehmen Südtirol als Durchreisende am Talboden oder auf Hangautobahnen wahr, sie würden ordentlich staunen, stiegen sie kurz aus und schauten nach oben.
Tatsächlich gibt es in Südtirol so etwas wie die „Oberschicht“, die knapp unterm Himmel in völliger Freiheit in einer eigenen Kultur wohnt. Diese Bergbauern kultivieren meist das Land knapp an der Baumgrenze, freilich können ihre Wirkungsstätten auch durchaus tiefer liegen, wenn es sich etwa um „Bergbauern des Weins“ handelt.

 „Einige Texte haben inzwischen etwas Patina angesetzt, andere sind noch aktuell. Sie zeugen sämtlich vom Versuch eines Sozialwissenschaftlers, das Tagesgeschehen zu analysieren, sich in die öffentliche Auseinandersetzung einzumischen und die Verantwortung des Forschers mit der des Bürgers in Einklang zu bringen.“ (9)
„Einige Texte haben inzwischen etwas Patina angesetzt, andere sind noch aktuell. Sie zeugen sämtlich vom Versuch eines Sozialwissenschaftlers, das Tagesgeschehen zu analysieren, sich in die öffentliche Auseinandersetzung einzumischen und die Verantwortung des Forschers mit der des Bürgers in Einklang zu bringen.“ (9) Ein Fernsehabend erlöst den anderen. - Wenn Sprichwort-artige klare Analysen im Spiel sind, ist Georg Paulmichl nicht weit. Er schafft es mit seinen beinahe täglichen Schreibüberlegungen, dem jeweiligen Tag und sich selbst den letzten Schliff zu geben.
Ein Fernsehabend erlöst den anderen. - Wenn Sprichwort-artige klare Analysen im Spiel sind, ist Georg Paulmichl nicht weit. Er schafft es mit seinen beinahe täglichen Schreibüberlegungen, dem jeweiligen Tag und sich selbst den letzten Schliff zu geben. „Man muss es immer wieder sagen: Der Schlüssel zur Lösung der Eurokrise liegt in der Hand Deutschlands und nicht in den Händen der kleinen Länder, die verzweifelt versuchen die Auflagen der Troika zu halten, und doch niemals erfolgreich sein können.“ (55)
„Man muss es immer wieder sagen: Der Schlüssel zur Lösung der Eurokrise liegt in der Hand Deutschlands und nicht in den Händen der kleinen Länder, die verzweifelt versuchen die Auflagen der Troika zu halten, und doch niemals erfolgreich sein können.“ (55)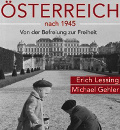 „Dieses Werk beginnt mit einem etwas unkonventionellen vierfachen Einstieg. Die Fragen, die uns bei der Erstellung der Bilddokumentation bewegten, lauteten: Was steht für das alte, was für das wiedererstandene, was für das neue und was in gewisser Weise immer noch für das heutige Österreich?“ (7)
„Dieses Werk beginnt mit einem etwas unkonventionellen vierfachen Einstieg. Die Fragen, die uns bei der Erstellung der Bilddokumentation bewegten, lauteten: Was steht für das alte, was für das wiedererstandene, was für das neue und was in gewisser Weise immer noch für das heutige Österreich?“ (7)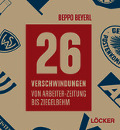 Da sucht man als Leser jahrelang einen Begriff für jene Dinge, die noch fragmentarisch in der Erinnerung da sind, aber im öffentlichen Leben schon verschwunden sind, und da kommt glücklicherweise Beppo Beyerl daher und hat ihn: Verschwindung.
Da sucht man als Leser jahrelang einen Begriff für jene Dinge, die noch fragmentarisch in der Erinnerung da sind, aber im öffentlichen Leben schon verschwunden sind, und da kommt glücklicherweise Beppo Beyerl daher und hat ihn: Verschwindung.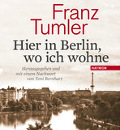 Die Frage nach dem sogenannten Erzählstandpunkt führt Autoren oft direkt ins Meldeamt, wo sie beinahe amtlich festlegen, wo sie wohnen.
Die Frage nach dem sogenannten Erzählstandpunkt führt Autoren oft direkt ins Meldeamt, wo sie beinahe amtlich festlegen, wo sie wohnen. Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend.
Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend. In ausgeklügelten sozialen Systemen genügt die Nennung der Wohnadresse, um die darin agierenden Personen bereits genauestens zuordnen und aburteilen zu können.
In ausgeklügelten sozialen Systemen genügt die Nennung der Wohnadresse, um die darin agierenden Personen bereits genauestens zuordnen und aburteilen zu können.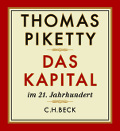 „Dennoch glaube ich, dass Forscher aus den Sozialwissenschaften wie allen anderen Disziplinen, Journalisten und Kommentatoren sämtlicher Medien, Gewerkschaftler und politische Aktivisten aller Richtungen, und vor allem sämtliche Bürger ernsthaft über Geld nachdenken sollten […]. Diejenigen, die viel davon haben, werden gewiss nicht vergessen, ihre Interessen zu verteidigen. Von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.“ (793)
„Dennoch glaube ich, dass Forscher aus den Sozialwissenschaften wie allen anderen Disziplinen, Journalisten und Kommentatoren sämtlicher Medien, Gewerkschaftler und politische Aktivisten aller Richtungen, und vor allem sämtliche Bürger ernsthaft über Geld nachdenken sollten […]. Diejenigen, die viel davon haben, werden gewiss nicht vergessen, ihre Interessen zu verteidigen. Von den Zahlen nichts wissen zu wollen, dient selten der Sache der Ärmsten.“ (793)