Susanne Gurschler, 111 Orte in Innsbruck, die man gesehen haben muss
 „Ich hoffe, dieses Buch inspiriert und motiviert Sie, mit wachem Blick durch die Straße und Gassen zu flanieren, offen zu sein für die versteckten Besonderheiten und Schönheiten Innsbrucks – bemerkenswert sind sie allemal!“ (Vorwort, S. 3)
„Ich hoffe, dieses Buch inspiriert und motiviert Sie, mit wachem Blick durch die Straße und Gassen zu flanieren, offen zu sein für die versteckten Besonderheiten und Schönheiten Innsbrucks – bemerkenswert sind sie allemal!“ (Vorwort, S. 3)
Von den 111 Orten in Innsbruck findet sich ein Großteil im Zentrum der Stadt rund um den alten Stadtkern aber auch die umliegenden Regionen, vom Flughafen bis Igls oder Arzl bieten zahlreiche Besonderheiten, die im Buch ausführlich zur Sprache kommen.

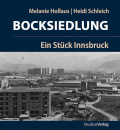 Der Ruf einer Gegend ist immer stark Kapital-abhängig. Solange die Stadt einen Stadtteil sich selbst überlässt, tut sie alles, um die Gegend schlecht zu reden, damit niemand dort Investitionen verlangt. Sobald man ein Geschäft mit der Entlegenheit wittert, redet man den Stadtteil schön und schreit insgesamt nach Olympischen Spielen. Generell lässt sich sagen, eine Gegend ist umso mieser, je weniger Politiker dort wohnen, um das Elend zu sehen.
Der Ruf einer Gegend ist immer stark Kapital-abhängig. Solange die Stadt einen Stadtteil sich selbst überlässt, tut sie alles, um die Gegend schlecht zu reden, damit niemand dort Investitionen verlangt. Sobald man ein Geschäft mit der Entlegenheit wittert, redet man den Stadtteil schön und schreit insgesamt nach Olympischen Spielen. Generell lässt sich sagen, eine Gegend ist umso mieser, je weniger Politiker dort wohnen, um das Elend zu sehen.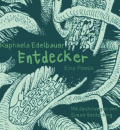 Im Idealfall gleicht ein Buch dem ersten Lesebuch, das einem damals die Welt erschlossen hat. Man wird als Leser jung, neugierig, zukunftsfroh und vollends optimistisch, dass da etwas drinnen steht, was man sofort und für alle Zeit gebrauchen kann.
Im Idealfall gleicht ein Buch dem ersten Lesebuch, das einem damals die Welt erschlossen hat. Man wird als Leser jung, neugierig, zukunftsfroh und vollends optimistisch, dass da etwas drinnen steht, was man sofort und für alle Zeit gebrauchen kann. Endlich hat ein Autor in einem klaren Satz zum Ausdruck gebracht, was einen ehemaligen Bundeskanzler wegen der Komplexität der Dinge in den schieren Wahnsinn getrieben hat.
Endlich hat ein Autor in einem klaren Satz zum Ausdruck gebracht, was einen ehemaligen Bundeskanzler wegen der Komplexität der Dinge in den schieren Wahnsinn getrieben hat.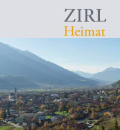 Als die heikelste Form, etwas zu erzählen, gilt jene, es über das Heimat-Buch zu betreiben. In seinem Heimatort nämlich ist jeder ein großer Erzähler, aber es gibt kaum Zuhörer. So löst ein Heimat-Buch immer große Diskussionen aus, ob auch alle Geschichten drin sind, ob sie richtig erzählt sind, ob die Namen richtig gedruckt sind und vor allem, ob auch niemand vergessen worden ist.
Als die heikelste Form, etwas zu erzählen, gilt jene, es über das Heimat-Buch zu betreiben. In seinem Heimatort nämlich ist jeder ein großer Erzähler, aber es gibt kaum Zuhörer. So löst ein Heimat-Buch immer große Diskussionen aus, ob auch alle Geschichten drin sind, ob sie richtig erzählt sind, ob die Namen richtig gedruckt sind und vor allem, ob auch niemand vergessen worden ist. Was das Familienalbum für die Angehörigen ist, ist der Architekturführer für die Stadtbewohner. Hier können die Zeitgenossen jeweils nachschauen, wie die Geliebten und Geschätzten beisammen sind. Denn Gebäude sind nicht nur die dritte Haut des Menschen, sondern auch ein Gegenüber, mit dem man diskutiert, indem man es betritt.
Was das Familienalbum für die Angehörigen ist, ist der Architekturführer für die Stadtbewohner. Hier können die Zeitgenossen jeweils nachschauen, wie die Geliebten und Geschätzten beisammen sind. Denn Gebäude sind nicht nur die dritte Haut des Menschen, sondern auch ein Gegenüber, mit dem man diskutiert, indem man es betritt.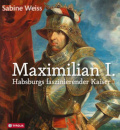 „Am 12. Januar 2019 jährt sich zum 500. Mal der Todestag Kaiser Maximilians I. Wer war dieser Herrscher? Ist es gerechtfertigt, seiner noch nach einem halben Jahrtausend zu gedenken? Ja, denn Maximilian war eine faszinierende Persönlichkeit: stets voller Ideen und Pläne, mit ritterliche Idealen, ein arbeitsamer Herrscher, schriftstellerisch tätig, ein Liebhaber der Musik, der Frauen und der Natur, mutig bis zur Waghalsigkeit, aber auch kriegslüstern, ehr- und ruhmsüchtig.“ (7)
„Am 12. Januar 2019 jährt sich zum 500. Mal der Todestag Kaiser Maximilians I. Wer war dieser Herrscher? Ist es gerechtfertigt, seiner noch nach einem halben Jahrtausend zu gedenken? Ja, denn Maximilian war eine faszinierende Persönlichkeit: stets voller Ideen und Pläne, mit ritterliche Idealen, ein arbeitsamer Herrscher, schriftstellerisch tätig, ein Liebhaber der Musik, der Frauen und der Natur, mutig bis zur Waghalsigkeit, aber auch kriegslüstern, ehr- und ruhmsüchtig.“ (7) „Jeder kann zeichnen und Kategorien wie richtig und falsch gelten hier nicht. Kinder stehen sich nicht mit Zweifeln selbst im Weg. Aber auch Erwachsene können mit derselben Freude zeichnen, wenn sie wissen, wie sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern können.“ (S. 10)
„Jeder kann zeichnen und Kategorien wie richtig und falsch gelten hier nicht. Kinder stehen sich nicht mit Zweifeln selbst im Weg. Aber auch Erwachsene können mit derselben Freude zeichnen, wenn sie wissen, wie sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern können.“ (S. 10)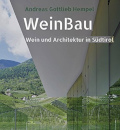 Die beiden wichtigsten Kulturtätigkeiten Südtirols sind nach allgemeiner Lesart die Kultivierung von Wein und das Bauen in der Landschaft.
Die beiden wichtigsten Kulturtätigkeiten Südtirols sind nach allgemeiner Lesart die Kultivierung von Wein und das Bauen in der Landschaft. Das Siegesdenkmal steht zwar in Bozen, beschäftigt aber wie jedes gute Denkmal das ganze Land, in diesem Falle ganz Tirol. Das Siegesdenkmal ist wie jedes gute Denkmal ständig vom Abriss bedroht und bringt dadurch ständig einen Diskurs auf die Beine. Abermals ein Beweis, dass es ein gutes Denkmal ist. Das Siegesdenkmal ist zur Zeit Anlass und Ort für eine denkwürdige Ausstellung, in der Macht, Herrschaft, Kultur, Baugeschichte und Gebrauch von Geschichte denkwürdig zum Ausdruck gebracht sind.
Das Siegesdenkmal steht zwar in Bozen, beschäftigt aber wie jedes gute Denkmal das ganze Land, in diesem Falle ganz Tirol. Das Siegesdenkmal ist wie jedes gute Denkmal ständig vom Abriss bedroht und bringt dadurch ständig einen Diskurs auf die Beine. Abermals ein Beweis, dass es ein gutes Denkmal ist. Das Siegesdenkmal ist zur Zeit Anlass und Ort für eine denkwürdige Ausstellung, in der Macht, Herrschaft, Kultur, Baugeschichte und Gebrauch von Geschichte denkwürdig zum Ausdruck gebracht sind.