Paolo Rumiz, Der Leuchtturm
 In der Literatur gilt der Leuchtturm als der Höhepunkt der Schreibkultur. Einerseits ist so ein entlegener Turm der beste Ort zum Schreiben, andererseits nimmt die Schrift das Licht der Lampe auf und leuchtet anschließend quer über die Regale der Neuerscheinungen. Gute Literatur hat Leuchtturmfunktion, heißt es dabei etwas geschwollen formuliert.
In der Literatur gilt der Leuchtturm als der Höhepunkt der Schreibkultur. Einerseits ist so ein entlegener Turm der beste Ort zum Schreiben, andererseits nimmt die Schrift das Licht der Lampe auf und leuchtet anschließend quer über die Regale der Neuerscheinungen. Gute Literatur hat Leuchtturmfunktion, heißt es dabei etwas geschwollen formuliert.
Paolo Rumiz ist Reisejournalist im erweiterten Sinn, mal tritt er dabei als Kriegsberichterstatter auf, dann als Sozialreporter und zwischendurch als philosophierender Literat. Die Grenzen sind fließend, wie sich überhaupt ein kluger Gedankenfluss nie einschränken lässt.

 Der Ruf einer Gegend ist immer stark Kapital-abhängig. Solange die Stadt einen Stadtteil sich selbst überlässt, tut sie alles, um die Gegend schlecht zu reden, damit niemand dort Investitionen verlangt. Sobald man ein Geschäft mit der Entlegenheit wittert, redet man den Stadtteil schön und schreit insgesamt nach Olympischen Spielen. Generell lässt sich sagen, eine Gegend ist umso mieser, je weniger Politiker dort wohnen, um das Elend zu sehen.
Der Ruf einer Gegend ist immer stark Kapital-abhängig. Solange die Stadt einen Stadtteil sich selbst überlässt, tut sie alles, um die Gegend schlecht zu reden, damit niemand dort Investitionen verlangt. Sobald man ein Geschäft mit der Entlegenheit wittert, redet man den Stadtteil schön und schreit insgesamt nach Olympischen Spielen. Generell lässt sich sagen, eine Gegend ist umso mieser, je weniger Politiker dort wohnen, um das Elend zu sehen. „Das Jahr 493 begann schlecht für die Einwohner Ravennas. Die Stadt war von der Außenwelt abgeschnitten. Lebensmittel waren kaum noch aufzutreiben und für viele unerschwinglich geworden, man hatte begonnen, alles zu essen, was sich kauen ließ, selbst Unkraut und Leder. […] Der Grund für diese Not war der Krieg, den die Könige Odovakar und Theoderich um die Herrschaft in Italien gegeneinander führten.“ (S. 15)
„Das Jahr 493 begann schlecht für die Einwohner Ravennas. Die Stadt war von der Außenwelt abgeschnitten. Lebensmittel waren kaum noch aufzutreiben und für viele unerschwinglich geworden, man hatte begonnen, alles zu essen, was sich kauen ließ, selbst Unkraut und Leder. […] Der Grund für diese Not war der Krieg, den die Könige Odovakar und Theoderich um die Herrschaft in Italien gegeneinander führten.“ (S. 15) Auf den alten Postkarten und mittlerweile im Netz gibt es diese Kurznachrichten, wo ein komplizierter Zustand auf einen Kurzsatz zusammengestutzt wird. „Aussichten sind überschätzt!“
Auf den alten Postkarten und mittlerweile im Netz gibt es diese Kurznachrichten, wo ein komplizierter Zustand auf einen Kurzsatz zusammengestutzt wird. „Aussichten sind überschätzt!“ „Wer will heute noch über das Recht diskutieren, Argumente auf ihre Prämissen überprüfen, Lebenszeit verausgaben, um nach Gründen für Recht und nach Gründen des Rechts zu suchen. Vom Recht ist nicht mehr die Rede, alle Welt ist nur noch an Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, Erlässen, Bescheiden, Urteilen und Weisungen interessiert. Es gibt keine Vorstellung von der notwendigen Differenz zwischen Ideal und Praxis.“ (S. 7)
„Wer will heute noch über das Recht diskutieren, Argumente auf ihre Prämissen überprüfen, Lebenszeit verausgaben, um nach Gründen für Recht und nach Gründen des Rechts zu suchen. Vom Recht ist nicht mehr die Rede, alle Welt ist nur noch an Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, Erlässen, Bescheiden, Urteilen und Weisungen interessiert. Es gibt keine Vorstellung von der notwendigen Differenz zwischen Ideal und Praxis.“ (S. 7)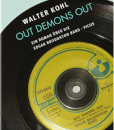 So um 1980 herum haben die damals sechzigjährigen Autoren in ihren aktuellen Romanen wie verrückt ihren Vater gesucht. Momentan versuchen die jetzt sechzigjährigen Kunden des Beats und der psychodelischen Musik mit ihren Bands von damals ins Reine zu kommen. Wahrscheinlich ist das nur eine andere Art von Vatersuche.
So um 1980 herum haben die damals sechzigjährigen Autoren in ihren aktuellen Romanen wie verrückt ihren Vater gesucht. Momentan versuchen die jetzt sechzigjährigen Kunden des Beats und der psychodelischen Musik mit ihren Bands von damals ins Reine zu kommen. Wahrscheinlich ist das nur eine andere Art von Vatersuche.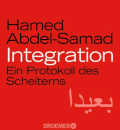 „Überspitzt formuliert könnte man sagen: Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten, sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18)
„Überspitzt formuliert könnte man sagen: Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten, sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18) „In der ersten Hälfte des 6. Jh. v. Chr. ereignete sich in einer Küstenstadt Groß-Griechenlands ein Vorgang von weitreichender, ja man darf sagen: von welthistorischer Bedeutung, »eine geistesgeschichtliche Revolution unerhörten Ausmaßes« deren Auswirkungen allerdings erst mehr als zweitausend Jahre später zu voller Geltung kommen.“ (Bd. 1, S. 13)
„In der ersten Hälfte des 6. Jh. v. Chr. ereignete sich in einer Küstenstadt Groß-Griechenlands ein Vorgang von weitreichender, ja man darf sagen: von welthistorischer Bedeutung, »eine geistesgeschichtliche Revolution unerhörten Ausmaßes« deren Auswirkungen allerdings erst mehr als zweitausend Jahre später zu voller Geltung kommen.“ (Bd. 1, S. 13) Beim Vorlesen lässt sich oft schwer feststellen, wer den größeren Genuss hat. Ist es die vorlesende Person oder die lauschende? Ähnliches passiert beim Erinnern, wer hat den größeren Nutzen? Jemand, der durch das Erinnern mit sich selbst ins Reine kommt, oder jemand, der durch die erinnerte Geschichte mit einer anderen Welt vertraut gemacht wird?
Beim Vorlesen lässt sich oft schwer feststellen, wer den größeren Genuss hat. Ist es die vorlesende Person oder die lauschende? Ähnliches passiert beim Erinnern, wer hat den größeren Nutzen? Jemand, der durch das Erinnern mit sich selbst ins Reine kommt, oder jemand, der durch die erinnerte Geschichte mit einer anderen Welt vertraut gemacht wird? „Gewiss, alles deutete längst darauf hin, dass es sich um einen kostbaren Fund handelt, allein die schiere Masse der Briefe, dieser dicke Stapel an Handschriften. Fast alles aus einer Feder! Aber dass es sich um längst vergessene Briefe von Maria Theresia, der einzigen Frau auf Habsburgs Thron, an die Mutter jenes Patenkindes handelt, ist eine Sensation, ein Geschenk des Zufalls …“ (S. 8)
„Gewiss, alles deutete längst darauf hin, dass es sich um einen kostbaren Fund handelt, allein die schiere Masse der Briefe, dieser dicke Stapel an Handschriften. Fast alles aus einer Feder! Aber dass es sich um längst vergessene Briefe von Maria Theresia, der einzigen Frau auf Habsburgs Thron, an die Mutter jenes Patenkindes handelt, ist eine Sensation, ein Geschenk des Zufalls …“ (S. 8)