Homer, Die Odyssee
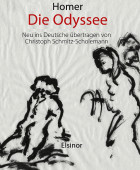 „Warum überhaupt sollte man jetzt die Odyssee lese? Nun, sie ist eine fabelhafte und spannende Reisegeschichte, obendrein gibt es Liebe, Hass, Schiffbruch, Mord und Totschlag und Himmel und Hölle. Auch erzählerisch ist die Odyssee ein hochraffiniertes Meisterwerk. Und ja, die Irrfahrten des Odysseus sind neben der Bibel eines der Ur-Narrative unsere Literatur. […] Aber das Beste: Die Odyssee hat bei näherem Hinsehen viel mit unserer heutigen, modernen Welt zu tun.“ (S. 7)
„Warum überhaupt sollte man jetzt die Odyssee lese? Nun, sie ist eine fabelhafte und spannende Reisegeschichte, obendrein gibt es Liebe, Hass, Schiffbruch, Mord und Totschlag und Himmel und Hölle. Auch erzählerisch ist die Odyssee ein hochraffiniertes Meisterwerk. Und ja, die Irrfahrten des Odysseus sind neben der Bibel eines der Ur-Narrative unsere Literatur. […] Aber das Beste: Die Odyssee hat bei näherem Hinsehen viel mit unserer heutigen, modernen Welt zu tun.“ (S. 7)
Die Odyssee ist das zweitälteste Werk der europäischen Literatur und dürfte zwischen dem Ende des 8. und Anfang 7. Jahrhunderts entstanden sein. Wie die Ilias wird die Odyssee dem mythischen Dichter Homer zugeschrieben. Inhaltlich schließt das Epos schließt an die Handlung der Ilias an und besingt die Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus, der von der Eroberung Trojas bis zu seiner Rückkehr nach Ithaka zehn Jahre durch die verschiedensten Orte der damaligen bekannten Welt getrieben wird.

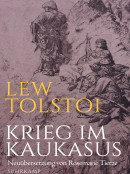 Tourismus und Krieg sind die Triebfedern dafür, dass wir uns zwischendurch für die Literatur scheinbar entlegener Gegenden interessieren. Manche halten den Tourismus für eine Sonderform des Krieges, was die Lesemotivation noch einmal vereinfacht. Am liebsten sind uns dabei Dinge, die uns schon vertraut sind.
Tourismus und Krieg sind die Triebfedern dafür, dass wir uns zwischendurch für die Literatur scheinbar entlegener Gegenden interessieren. Manche halten den Tourismus für eine Sonderform des Krieges, was die Lesemotivation noch einmal vereinfacht. Am liebsten sind uns dabei Dinge, die uns schon vertraut sind. Als die Erde noch eine Scheibe ist, ist die Ebene so etwas wie die ganze plane Welt, die man sich vorstellen kann. Später wird aus den Ebenen etwas Geographisches, worin sich vorzüglich Schlachten abwickeln lassen, das Kind spielt mit der Ebene, worin es diverse Figuren aufstellt und schließlich sind wir Literaturmenschen immer hingerissen von den Ebenen. Spielebene, Sprachebene, Metaebene, an manchen Tagen verlieren wir uns beim Lesen darin.
Als die Erde noch eine Scheibe ist, ist die Ebene so etwas wie die ganze plane Welt, die man sich vorstellen kann. Später wird aus den Ebenen etwas Geographisches, worin sich vorzüglich Schlachten abwickeln lassen, das Kind spielt mit der Ebene, worin es diverse Figuren aufstellt und schließlich sind wir Literaturmenschen immer hingerissen von den Ebenen. Spielebene, Sprachebene, Metaebene, an manchen Tagen verlieren wir uns beim Lesen darin. Wer muss da nicht zugreifen: ein Buch mit Lesebändchen, saftig-erotischem Stich im Umschlaginneren und draußen am Pergament-goldenen Cover die herausquellenden Worte „Versuch über die Hurerei“!
Wer muss da nicht zugreifen: ein Buch mit Lesebändchen, saftig-erotischem Stich im Umschlaginneren und draußen am Pergament-goldenen Cover die herausquellenden Worte „Versuch über die Hurerei“!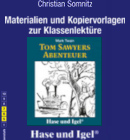 „Das Begleitmaterial greift verschiedene inhaltliche, sprachliche, historische und gesellschaftlich-ethische Aspekte des Romans auf. […] Jeder Abschnitt beginnt mit einem Lehrerteil, in dem sich Hinweise zu den Kopiervorlagen, sowie zusätzliche Vorschläge für Gesprächs- oder Schreibanlässe befinden.“ (S. 4)
„Das Begleitmaterial greift verschiedene inhaltliche, sprachliche, historische und gesellschaftlich-ethische Aspekte des Romans auf. […] Jeder Abschnitt beginnt mit einem Lehrerteil, in dem sich Hinweise zu den Kopiervorlagen, sowie zusätzliche Vorschläge für Gesprächs- oder Schreibanlässe befinden.“ (S. 4)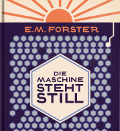 Die Literatur belohnt sich manchmal selbst, indem sie Prophezeiungen, tatsächlich eintreten lässt und eine Post-Dystopie daraus macht.
Die Literatur belohnt sich manchmal selbst, indem sie Prophezeiungen, tatsächlich eintreten lässt und eine Post-Dystopie daraus macht.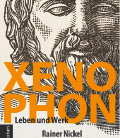 „Die vorliegende Darstellung möchte dazu beitragen, Xenophons Persönlichkeit zu verstehen und dabei nicht nur seinen Lebenslauf, seine kulturelle Umwelt, seine literarischen Voraussetzungen und Absichten und seine spezifischen Arbeitstechniken, sondern auch seine politischen Anschauungen und Überzeugungen kennenzulernen.“ (4)
„Die vorliegende Darstellung möchte dazu beitragen, Xenophons Persönlichkeit zu verstehen und dabei nicht nur seinen Lebenslauf, seine kulturelle Umwelt, seine literarischen Voraussetzungen und Absichten und seine spezifischen Arbeitstechniken, sondern auch seine politischen Anschauungen und Überzeugungen kennenzulernen.“ (4)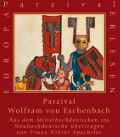 „Den Männern und den Frauen / verbot sie allen auf den Tod, / dass sie je von den Rittern sprechen. / »Denn wüsste meines Herzens Schatz, / was dieses Ritterleben sei, / dann würd‘ mir das zum großen Unheil. / Nun haltet euch an die Vernunft / und sagt nichts von der Ritterwelt.«“ (118)
„Den Männern und den Frauen / verbot sie allen auf den Tod, / dass sie je von den Rittern sprechen. / »Denn wüsste meines Herzens Schatz, / was dieses Ritterleben sei, / dann würd‘ mir das zum großen Unheil. / Nun haltet euch an die Vernunft / und sagt nichts von der Ritterwelt.«“ (118) Kampfschriften, Aufrufe und Epochen-Essays lösen im Idealfall viel mehr aus, als es dem meist schmalen Text auf den ersten Blick zugemutet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen „Text-Preziosen“ ist immer auch eine Überlegung darüber, wem so ein Diskurs nützen könnte.
Kampfschriften, Aufrufe und Epochen-Essays lösen im Idealfall viel mehr aus, als es dem meist schmalen Text auf den ersten Blick zugemutet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesen „Text-Preziosen“ ist immer auch eine Überlegung darüber, wem so ein Diskurs nützen könnte. Wenn es einem Dichter gelingt, den archaischen Lebenskampf durch Saufen zu unterlegen und dabei noch Patriotismus zu entwickeln, steht einem flächendeckenden Absingen seiner Hymnen nichts mehr im Wege.
Wenn es einem Dichter gelingt, den archaischen Lebenskampf durch Saufen zu unterlegen und dabei noch Patriotismus zu entwickeln, steht einem flächendeckenden Absingen seiner Hymnen nichts mehr im Wege.