Dine Petrik, Handgewebe lapisblau
 Großes Stimmungskino kann in der Literatur oft mit einem Farbton umschrieben werden, man denke an die rosa Brille oder den alle Sinnesorgane umfassenden Blues.
Großes Stimmungskino kann in der Literatur oft mit einem Farbton umschrieben werden, man denke an die rosa Brille oder den alle Sinnesorgane umfassenden Blues.
Dine Petrik setzt ihre Gedichte hinter eine Linse aus „lapisblau“, fein assoziierend, dass rare Farben oft herhalten für politische Formationen, man denke nur an die Blauen oder die Türkisen. Das Genre „Handgewebe“ deutet freilich auf manuelle Kunstfertigkeit hin, auf Geduld von Gewebe und fein gegliederter Stofflichkeit. Ein mit der Hand geschriebener Text kann so als Textur von einzigartigen Arbeitsschritten gelesen werden.

 Das Genre Verwicklungsroman behandelt mehrere Handlungsstränge, die an sogenannten Umsteigeknoten einen Wechsel in eine neue Erzählung ermöglichen. Der österreichische Verwicklungsroman gleicht ziemlich genau dem Netz der österreichischen Bundesbahnen, das heißt, er kann von einer Person mit einem einzigen Ticket innerhalb von ein paar Halbtagen abgefahren werden.
Das Genre Verwicklungsroman behandelt mehrere Handlungsstränge, die an sogenannten Umsteigeknoten einen Wechsel in eine neue Erzählung ermöglichen. Der österreichische Verwicklungsroman gleicht ziemlich genau dem Netz der österreichischen Bundesbahnen, das heißt, er kann von einer Person mit einem einzigen Ticket innerhalb von ein paar Halbtagen abgefahren werden.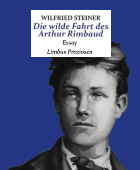 Ein gutes Lesebändchen ist stets aufgeregt, wenn es wo eingelegt wird. Es kommuniziert mit den Lesern und fragt stumm, warum es in welcher Reihenfolge wo eingelegt wird.
Ein gutes Lesebändchen ist stets aufgeregt, wenn es wo eingelegt wird. Es kommuniziert mit den Lesern und fragt stumm, warum es in welcher Reihenfolge wo eingelegt wird.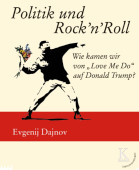 „Seit den frühen Sechzigern bis weit in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts hinein war Rock´n Roll der bevorzugte Schauplatz für den Tanz des Zeitgeistes. Dieser Geist ist natürlich auch in anderen Bereichen präsent – wie im Kino, im Theater, in der bildenden Kunst und der Literatur, mit denen ich mich ebenfalls befassen werde.“ (S. 10)
„Seit den frühen Sechzigern bis weit in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts hinein war Rock´n Roll der bevorzugte Schauplatz für den Tanz des Zeitgeistes. Dieser Geist ist natürlich auch in anderen Bereichen präsent – wie im Kino, im Theater, in der bildenden Kunst und der Literatur, mit denen ich mich ebenfalls befassen werde.“ (S. 10)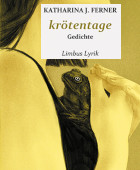 Die Nachrichtenwelt verschiebt sich ständig wie die Platten der Erdkruste. Stoßen die Textblöcke aneinander, sind oft Erschütterung und Vulkanismus angesagt. Das Individuum wird von dieser Lage mitgerissen und schützt sich, indem es sich mit einem Panzer aus Eigensinn und Eigenwelt umgibt. In dieser Erregungszone gedeihen Liebesgedichte meist vortrefflich, weil sie durch Abschirmung, Ironie und Abschweifung das Intime mit dem Zeitgeist in Verbindung bringen.
Die Nachrichtenwelt verschiebt sich ständig wie die Platten der Erdkruste. Stoßen die Textblöcke aneinander, sind oft Erschütterung und Vulkanismus angesagt. Das Individuum wird von dieser Lage mitgerissen und schützt sich, indem es sich mit einem Panzer aus Eigensinn und Eigenwelt umgibt. In dieser Erregungszone gedeihen Liebesgedichte meist vortrefflich, weil sie durch Abschirmung, Ironie und Abschweifung das Intime mit dem Zeitgeist in Verbindung bringen.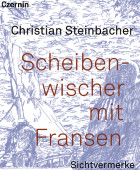 Im Flanieren durch Gärten, Vororte oder Rentnerareale bleibt man oft stehen und geht einen Schritt zurück, um sich etwas genauer anzusehen, das beim ersten Vorbeigehen nur als Irritation aufgefallen ist. „Scheibenwischer mit Fransen“ wäre so eine Begebenheit, an der man zuerst vorbeigeht, ehe man sich umdreht und die Fügung unter das sprachliche Okular nimmt.
Im Flanieren durch Gärten, Vororte oder Rentnerareale bleibt man oft stehen und geht einen Schritt zurück, um sich etwas genauer anzusehen, das beim ersten Vorbeigehen nur als Irritation aufgefallen ist. „Scheibenwischer mit Fransen“ wäre so eine Begebenheit, an der man zuerst vorbeigeht, ehe man sich umdreht und die Fügung unter das sprachliche Okular nimmt. Wenn ein physikalisches Thema mit einem Nobelpreis für Physik ausgestattet wird, sollte dann nicht auch in der Lyrik dieses Thema aufgegriffen werden?
Wenn ein physikalisches Thema mit einem Nobelpreis für Physik ausgestattet wird, sollte dann nicht auch in der Lyrik dieses Thema aufgegriffen werden?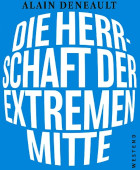 „Was kann ein Mittelmäßiger am besten? Einen anderen Mittelmäßigen erkennen. Sie tun sich zusammen, kraulen sich gegenseitig das Fell und danken es mit einer Gegenleistung, um einem wachsenden Klan den Rücken zu stärken, denn schon bald werden sie andere Mittelmäßige anziehen. Wichtig dabei ist nicht so sehr, Dummheit zu vermeiden, als sie mit Bildern der Macht zu schmücken.“ (S. 11)
„Was kann ein Mittelmäßiger am besten? Einen anderen Mittelmäßigen erkennen. Sie tun sich zusammen, kraulen sich gegenseitig das Fell und danken es mit einer Gegenleistung, um einem wachsenden Klan den Rücken zu stärken, denn schon bald werden sie andere Mittelmäßige anziehen. Wichtig dabei ist nicht so sehr, Dummheit zu vermeiden, als sie mit Bildern der Macht zu schmücken.“ (S. 11) Bücherfreunde wissen: Die Steigerung von Buch heißt Umkehrbuch. Das ist eine Art U-Turn, wie man ihn im Rallye-Sport kennt. Man hält das Buch wie immer, macht einen U-Turn, und hat plötzlich ein anderes Buch in der Hand. Die erste Frage bei der Lektüre eines Split-Buches lautet folglich: Was lese ich zuerst? Lese ich in einem Zug bis zur Mitte, oder wechsle ich nach jedem Gedicht die Buchhälfte?
Bücherfreunde wissen: Die Steigerung von Buch heißt Umkehrbuch. Das ist eine Art U-Turn, wie man ihn im Rallye-Sport kennt. Man hält das Buch wie immer, macht einen U-Turn, und hat plötzlich ein anderes Buch in der Hand. Die erste Frage bei der Lektüre eines Split-Buches lautet folglich: Was lese ich zuerst? Lese ich in einem Zug bis zur Mitte, oder wechsle ich nach jedem Gedicht die Buchhälfte?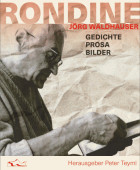 Vor Jahrzehnten, als die Heranwachsenden noch hirnlos in den Tag hineinstudiern konnten und anschließend einen Job ins Maul geflogen bekamen, machte in Tirol ein seltsames Gerücht die Runde: In Hall sitzt in der Nudelfabrik während der Nacht ein Philosoph an der Pforte und sinniert während seiner Aufsicht über den Sinn der Welt nach.
Vor Jahrzehnten, als die Heranwachsenden noch hirnlos in den Tag hineinstudiern konnten und anschließend einen Job ins Maul geflogen bekamen, machte in Tirol ein seltsames Gerücht die Runde: In Hall sitzt in der Nudelfabrik während der Nacht ein Philosoph an der Pforte und sinniert während seiner Aufsicht über den Sinn der Welt nach.