Tom Zürcher, Liebe Rock
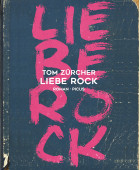 Der gute Dichter textet alles, was das Leben von ihm verlangt. Tom Zürcher hat diese literarische Hauptaussage vorsorglich in die eigene Biographie verlagert. Dort ist sie auch dann noch von Nutzen, wenn sich ein Buch mit all seinen Weisheiten nicht am Literaturmarkt bewähren sollte. Und diese literarische Programmatik bringt zudem den gegenwärtigen Literaturbetrieb auf den Punkt.
Der gute Dichter textet alles, was das Leben von ihm verlangt. Tom Zürcher hat diese literarische Hauptaussage vorsorglich in die eigene Biographie verlagert. Dort ist sie auch dann noch von Nutzen, wenn sich ein Buch mit all seinen Weisheiten nicht am Literaturmarkt bewähren sollte. Und diese literarische Programmatik bringt zudem den gegenwärtigen Literaturbetrieb auf den Punkt.
Im Sinne der Postmoderne muss der Leser mitmachen und die finale Ordnung der Lektüre besorgen, der Autor bringt das Knowhow aus der Szene der Literaturhäuser und Schreibwerkstätten mit, und die überschaubar wenigen Figuren sind aus den Verlagskatalogen abgeschrieben, wo sie die Felder Kindheit, Erziehung, Liebe, Hund, Behinderung abdecken. Und es gibt keinen Unterschied zwischen der schreibenden Figur, dem Leser und dem abgedruckten Portfolio an Handlungen und Gesprächen.

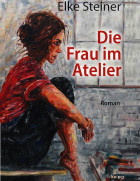 Künstler müssen nicht unbedingt ein Werk abliefern, um zumindest für die Steuer als solche gewürdigt zu werden. Ohne ihr Zutun entwickeln sie sich manchmal zu Inszenierungs-, Konzept- oder Hungerkünstlern.
Künstler müssen nicht unbedingt ein Werk abliefern, um zumindest für die Steuer als solche gewürdigt zu werden. Ohne ihr Zutun entwickeln sie sich manchmal zu Inszenierungs-, Konzept- oder Hungerkünstlern.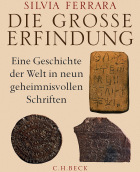 „Dieses Buch handelt weder von der griechischen Antike noch vom Alphabet, und es auch kein historischer Essay, sondern gewissermaßen eine Erzählung, die von einer Erfindung handelt: von der größten der Welt. Gewissermaßen, weil sie zwar einen Anfang hat und von einer abenteuerlichen Reise um die Welt handelt, ihr Ende aber erst noch geschrieben werden muss.“ (S. 9)
„Dieses Buch handelt weder von der griechischen Antike noch vom Alphabet, und es auch kein historischer Essay, sondern gewissermaßen eine Erzählung, die von einer Erfindung handelt: von der größten der Welt. Gewissermaßen, weil sie zwar einen Anfang hat und von einer abenteuerlichen Reise um die Welt handelt, ihr Ende aber erst noch geschrieben werden muss.“ (S. 9)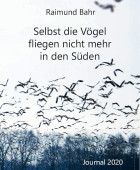 Jahreszahlen auf Buchcovern lösen im Lesegedächtnis unverschlüsselte Reaktionen aus. Wenn die seltsame Zahl 2020 aufblitzt, erweckt sie ähnlich wie seinerzeit 1914 ein mulmiges Gefühl, geht es doch bei beiden Jahren um große Katastrophen.
Jahreszahlen auf Buchcovern lösen im Lesegedächtnis unverschlüsselte Reaktionen aus. Wenn die seltsame Zahl 2020 aufblitzt, erweckt sie ähnlich wie seinerzeit 1914 ein mulmiges Gefühl, geht es doch bei beiden Jahren um große Katastrophen.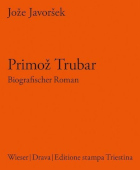 Damit sich ein Staat gegenüber anderen Staaten legitimieren kann, braucht er neben Fahnen, Verfassung, Verteidigung und Währung auch den Nachweis, dass er lesen und schreiben kann. Ursprünglich mussten nur Kirchenleute und Kriegsherrn nachweisen, dass sie zumindest Urkunden lesen können, in demokratisch organisierten Gebilden ist es unumgänglich, dass es auch eine Literatur gibt, die aus dem Volk für das Volk gemacht wird.
Damit sich ein Staat gegenüber anderen Staaten legitimieren kann, braucht er neben Fahnen, Verfassung, Verteidigung und Währung auch den Nachweis, dass er lesen und schreiben kann. Ursprünglich mussten nur Kirchenleute und Kriegsherrn nachweisen, dass sie zumindest Urkunden lesen können, in demokratisch organisierten Gebilden ist es unumgänglich, dass es auch eine Literatur gibt, die aus dem Volk für das Volk gemacht wird. „Eine der großen Herausforderungen im künstlerischen Schaffen besteht heute darin, wie man persönlich mit der nahezu unvermeidbaren Verbindung von digitalen und analogen Momenten in der eigenen Arbeit umgeht. Diese Fragestellung war noch vor zwei oder drei Jahrzehnten kaum abzusehen. Dementsprechend unvorbereitet, bisweilen auch frisch und neu sind die Antworten, vergleichbar mit dem Aufkommen der Abstraktion und des Films vor hundert Jahren.“ (S. 19)
„Eine der großen Herausforderungen im künstlerischen Schaffen besteht heute darin, wie man persönlich mit der nahezu unvermeidbaren Verbindung von digitalen und analogen Momenten in der eigenen Arbeit umgeht. Diese Fragestellung war noch vor zwei oder drei Jahrzehnten kaum abzusehen. Dementsprechend unvorbereitet, bisweilen auch frisch und neu sind die Antworten, vergleichbar mit dem Aufkommen der Abstraktion und des Films vor hundert Jahren.“ (S. 19)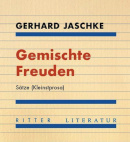 Ab wann wird der Nagel, an dem das Bild hängt, selbst zum Bild? Wie stark muss ein Satz sein, dass er einen Absatz tragen kann? Wie fett darf eine Headline ausfallen, dass sie den darunterliegenden Text gerade noch nicht erschlägt?
Ab wann wird der Nagel, an dem das Bild hängt, selbst zum Bild? Wie stark muss ein Satz sein, dass er einen Absatz tragen kann? Wie fett darf eine Headline ausfallen, dass sie den darunterliegenden Text gerade noch nicht erschlägt?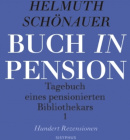 „Jeder, der von Helmuth Schönauers fünftausend Buchbesprechungen erfährt, fragt sich, wie schreibt man fünftausend Buchbesprechungen, und wieso tut man das.“ (S. 5)
„Jeder, der von Helmuth Schönauers fünftausend Buchbesprechungen erfährt, fragt sich, wie schreibt man fünftausend Buchbesprechungen, und wieso tut man das.“ (S. 5) Wenn man lange genug magisch auf eine Gegend schaut, entsteht dabei die Literatur wie von selbst. Der schwedische Wald hat, wie übrigens auch der Innsbrucker Mitterweg, die Kraft, täglich neue Geschichten wachsen zu lassen.
Wenn man lange genug magisch auf eine Gegend schaut, entsteht dabei die Literatur wie von selbst. Der schwedische Wald hat, wie übrigens auch der Innsbrucker Mitterweg, die Kraft, täglich neue Geschichten wachsen zu lassen. Ein Roman gilt üblicherweise als Podium für Üppigkeit von Figuren und Ausstattung, Verknotung von Handlungen, Spiegelung von winkeligen Seelensträngen. Das Gegenteil müsste so etwas wie der Zen-Roman sein, ein Text voller Reduktion bis hin zur Auflösung jeglicher Konsistenz.
Ein Roman gilt üblicherweise als Podium für Üppigkeit von Figuren und Ausstattung, Verknotung von Handlungen, Spiegelung von winkeligen Seelensträngen. Das Gegenteil müsste so etwas wie der Zen-Roman sein, ein Text voller Reduktion bis hin zur Auflösung jeglicher Konsistenz.