Reinhard Wegerth, Die besten Wunder
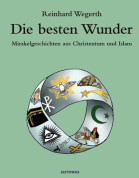 Suche den Kern der Hülle! – In der Literatur gibt es ständig neue Rätsel zu lösen, deren Lösungen später wieder zum Aufbau neuer Rätsel genutzt werden können. Reinhard Wegerth nimmt die „besten Wunder“ aus den Gründungsmythen von Islam und Christentum unter seine literarischen Fittiche, indem er sie ohne Vorurteile behutsam aus dem religiösen Kontext schält und als Präparate der Fiktion unter das Lektüre-Mikroskop legt.
Suche den Kern der Hülle! – In der Literatur gibt es ständig neue Rätsel zu lösen, deren Lösungen später wieder zum Aufbau neuer Rätsel genutzt werden können. Reinhard Wegerth nimmt die „besten Wunder“ aus den Gründungsmythen von Islam und Christentum unter seine literarischen Fittiche, indem er sie ohne Vorurteile behutsam aus dem religiösen Kontext schält und als Präparate der Fiktion unter das Lektüre-Mikroskop legt.
Während das Genre Wunder in der Hauptsache bei religiös funktionierenden Geschichten zum Einsatz kommt, ist der Ausdruck „Mirakel“ schon ziemlich profan gedeutet. Schließlich steht beim Mirakel eher der Unterhaltungswert eines Ereignisses im Vordergrund, und das Staunen als Zeitvertreib ersetzt den moralisch dehydrierten Zeigefinger.

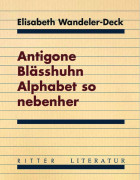 Literatur ist jene dünne Haut, die sich schützend zwischen Ordnung und Unordnung stellt. Ohne sie gäbe es weder das eine noch das andere, folglich nichts. Die Literatur erschafft somit die Welt, wie wir sie uns vorstellen.
Literatur ist jene dünne Haut, die sich schützend zwischen Ordnung und Unordnung stellt. Ohne sie gäbe es weder das eine noch das andere, folglich nichts. Die Literatur erschafft somit die Welt, wie wir sie uns vorstellen. Die sensiblen Kunstformen Gedicht und Kurzgeschichten lassen sich in ihrer Halbwertszeit des Verfalls hinauszögern, wenn das Gedicht prosaische Züge trägt und die Kurzgeschichte psychologisch-poetische Tiefen aufsucht.
Die sensiblen Kunstformen Gedicht und Kurzgeschichten lassen sich in ihrer Halbwertszeit des Verfalls hinauszögern, wenn das Gedicht prosaische Züge trägt und die Kurzgeschichte psychologisch-poetische Tiefen aufsucht. Während man bei einem Roman davon ausgeht, dass er zum Augenblick seiner Vollendung mit Ort und Zeit als Quelldaten fixiert wird, zeigen sich Erzählbände oft als Bunter Text-Kessel, der an mannigfaltigen Orten aufgekocht und über Jahrzehnte eingedickt worden ist.
Während man bei einem Roman davon ausgeht, dass er zum Augenblick seiner Vollendung mit Ort und Zeit als Quelldaten fixiert wird, zeigen sich Erzählbände oft als Bunter Text-Kessel, der an mannigfaltigen Orten aufgekocht und über Jahrzehnte eingedickt worden ist. pätestens seit Daniel Defoe gilt ein entlegenes Eiland als ideale Erzählfläche, um darauf Lebens- und Weltentwürfe spielen zu lassen. Wenn diese Insel dann noch einer definitiven Zeit entrückt wird, indem quasi jede Zeit auf der Insel Platz hat, dann erweist sich die „Zeitinsel“ als höchst verdichtetes Material, das astrophysikalisch vielleicht an ein schwarzes Loch herankommt.
pätestens seit Daniel Defoe gilt ein entlegenes Eiland als ideale Erzählfläche, um darauf Lebens- und Weltentwürfe spielen zu lassen. Wenn diese Insel dann noch einer definitiven Zeit entrückt wird, indem quasi jede Zeit auf der Insel Platz hat, dann erweist sich die „Zeitinsel“ als höchst verdichtetes Material, das astrophysikalisch vielleicht an ein schwarzes Loch herankommt.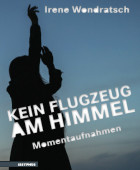 Dem Tagebuch ist es egal, was in der Welt draußen passiert, es schreibt sich zwischen den Buchdeckeln von selbst voll.
Dem Tagebuch ist es egal, was in der Welt draußen passiert, es schreibt sich zwischen den Buchdeckeln von selbst voll.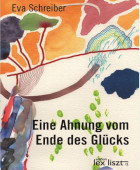 Glück ist ein treffsicheres Wort, denn alle Sätze damit sind richtig. So lautet eine besonders freche Definition: Glück ist das Ablaufdatum, an dem „es“ vorbei ist.
Glück ist ein treffsicheres Wort, denn alle Sätze damit sind richtig. So lautet eine besonders freche Definition: Glück ist das Ablaufdatum, an dem „es“ vorbei ist.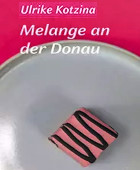 Die zwei positiven Zutaten Fluss und Getränk ergeben bei gutem Licht ein anregendes Denk- und Sitzklima. „Melange an der Donau“ beschreibt eine Menge Stimmung, die in einem Stillleben kulminiert, worin bei guter Witterung Menschen im Freien sitzen und auf die Donau blicken, während sie die Melange umrühren.
Die zwei positiven Zutaten Fluss und Getränk ergeben bei gutem Licht ein anregendes Denk- und Sitzklima. „Melange an der Donau“ beschreibt eine Menge Stimmung, die in einem Stillleben kulminiert, worin bei guter Witterung Menschen im Freien sitzen und auf die Donau blicken, während sie die Melange umrühren. Im Zeitalter von Hashtag-Überschriften ist es durchaus üblich, den Plot einer Nachricht in ein zusammengepresstes ZIP-Wort zu verpacken. Die deutsche Sprache neigt ohnehin zu Wortverpressungen, man denke nur an die Lust diverser Regierungen, ein Gesetz in Wortmonster zu verpacken und als „Gute-Kita-Gesetz“ zu beschließen.
Im Zeitalter von Hashtag-Überschriften ist es durchaus üblich, den Plot einer Nachricht in ein zusammengepresstes ZIP-Wort zu verpacken. Die deutsche Sprache neigt ohnehin zu Wortverpressungen, man denke nur an die Lust diverser Regierungen, ein Gesetz in Wortmonster zu verpacken und als „Gute-Kita-Gesetz“ zu beschließen. Die meisten Pflanzen und Lebewesen drängen, wenn möglich, ins Helle und an die Sonne. Bei den Menschen freilich führt dieses Streben oft stracks ins Dunkel, und manches Schicksal scheint eine Bewegung „schattenwärts“ zu sein.
Die meisten Pflanzen und Lebewesen drängen, wenn möglich, ins Helle und an die Sonne. Bei den Menschen freilich führt dieses Streben oft stracks ins Dunkel, und manches Schicksal scheint eine Bewegung „schattenwärts“ zu sein.