Ludwig Roman Fleischer, Weana Gschicht und Weana Gschichtln
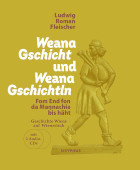 Das Buch von der Wiener Universal-Geschichte betritt man am besten, indem man wie durch einen akustischen Triumphbogen der Sprache mit zwei CDs hineinhüpft in den Text. „Weana Gschicht“ ist eine mündliche Angelegenheit, gleichsam öffentlich wie intim. Im Vorsatz sind die beiden güldenen CDs eingeklemmt. Der beigestellte Buchtext hat die Funktion, das Auge still zu halten, damit sich das Gehör konzentrieren kann. Wie eine Partitur zeigt der Text vor allem die Gliederung, die dem Jahrhundertwerk innewohnt.
Das Buch von der Wiener Universal-Geschichte betritt man am besten, indem man wie durch einen akustischen Triumphbogen der Sprache mit zwei CDs hineinhüpft in den Text. „Weana Gschicht“ ist eine mündliche Angelegenheit, gleichsam öffentlich wie intim. Im Vorsatz sind die beiden güldenen CDs eingeklemmt. Der beigestellte Buchtext hat die Funktion, das Auge still zu halten, damit sich das Gehör konzentrieren kann. Wie eine Partitur zeigt der Text vor allem die Gliederung, die dem Jahrhundertwerk innewohnt.
Ludwig Roman Fleischer ist ein Sprachkünstler und Erwachsenenbildner. Mit seinem ironischen Duktus stellt er fürs erste klar, dass man ruhig seiner Stimme lauschen kann, es wird keine spannendere in der nächsten Zeit auftreten. Und die voluminöse Prägnanz gibt dem Vortrag jene Glaubwürdigkeit, die es braucht, um die volle Wucht des Themas „Geschichte“ auszuhalten.

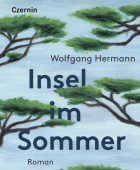 Wenn etwas gebrochen ist, muss die Literatur wie ein Stützverband um die kaputten Stellen gelegt werden. Dabei ist viel Heilungsglaube vonnöten, sonst wirkt es nicht.
Wenn etwas gebrochen ist, muss die Literatur wie ein Stützverband um die kaputten Stellen gelegt werden. Dabei ist viel Heilungsglaube vonnöten, sonst wirkt es nicht.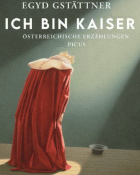 Patriotisches Selbstbewusstsein kann manchmal in einen Cäsarenkult übergehen, wenn das Land mitspielt und den darin geäußerten Wahnvorstellungen ein Revier gibt. Das bayrische „Mia san mia“ ist genauso patriotisch-pfiffig, wie das berüchtigte „Ik bin ein Berliner“. Da ist die Weltformel eines Österreichers geradezu romantisch: Ich bin Kaiser.
Patriotisches Selbstbewusstsein kann manchmal in einen Cäsarenkult übergehen, wenn das Land mitspielt und den darin geäußerten Wahnvorstellungen ein Revier gibt. Das bayrische „Mia san mia“ ist genauso patriotisch-pfiffig, wie das berüchtigte „Ik bin ein Berliner“. Da ist die Weltformel eines Österreichers geradezu romantisch: Ich bin Kaiser.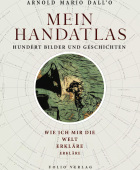 Ähnlich dem Rechenschieber und dem Schwindel-Wörterbuch für die Schularbeit ist der Atlas ein didaktisches Erinnerungsstück, das von einer Welt berichtet, als die Dinge noch zum Angreifen waren, so weit weg sie auch sein mochten.
Ähnlich dem Rechenschieber und dem Schwindel-Wörterbuch für die Schularbeit ist der Atlas ein didaktisches Erinnerungsstück, das von einer Welt berichtet, als die Dinge noch zum Angreifen waren, so weit weg sie auch sein mochten.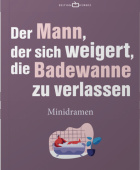 Das Genre „Minidrama“ wird oft den Beatniks zugeschrieben, weil diese sich längst am Rand großer Dramen ansiedelt haben. Wenn die Mittel so beschränkt sind, dass es nicht einmal für Bühne, Kulisse, Vorhang – geschweige denn für einen Souffleurkasten – reicht, dann bleibt als letzter Ausweg nur das Minidrama. Darin ist die Autorenschaft des prekären literarischen Lebens bestens geschult. Jeder, der am Rand der Event-Kultur lebt, hat zumindest ein Minidrama in der Tasche, mit dem sich Zutritt in die Theaterwelt des Alltags verschaffen lässt.
Das Genre „Minidrama“ wird oft den Beatniks zugeschrieben, weil diese sich längst am Rand großer Dramen ansiedelt haben. Wenn die Mittel so beschränkt sind, dass es nicht einmal für Bühne, Kulisse, Vorhang – geschweige denn für einen Souffleurkasten – reicht, dann bleibt als letzter Ausweg nur das Minidrama. Darin ist die Autorenschaft des prekären literarischen Lebens bestens geschult. Jeder, der am Rand der Event-Kultur lebt, hat zumindest ein Minidrama in der Tasche, mit dem sich Zutritt in die Theaterwelt des Alltags verschaffen lässt.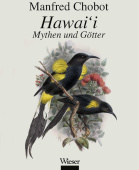 Extreme Landschaften bringen meist extreme Sagen hervor, das heißt, diese Sagen erzählen sich wie von selbst aus der Erde heraus. So sprudeln aufregende Heldentaten gerne aus den Alpen hervor, aus der Donau und manchmal als witzige Irrläufer aus der Stadt Wien.
Extreme Landschaften bringen meist extreme Sagen hervor, das heißt, diese Sagen erzählen sich wie von selbst aus der Erde heraus. So sprudeln aufregende Heldentaten gerne aus den Alpen hervor, aus der Donau und manchmal als witzige Irrläufer aus der Stadt Wien.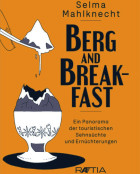 Tourismus ist wie Sex: Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ist er kaputt. Durch das Format Essay werden derlei Gefährdungen minimiert. Im Essay darf nämlich auf gesicherten Fakten subjektiv nachgedacht werden.
Tourismus ist wie Sex: Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ist er kaputt. Durch das Format Essay werden derlei Gefährdungen minimiert. Im Essay darf nämlich auf gesicherten Fakten subjektiv nachgedacht werden.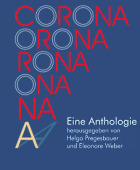 Bei der Stofflektüre aus dem Ersten Weltkrieg ist es nach hundert Jahren egal, ob jemand in den ersten Wochen gestorben ist, wie Georg Trakl 1914 in Grodek, oder im zweiten Jahr der Katastrophe, wie August Stramm 1915 am Dnjepr-Bug-Kanal.
Bei der Stofflektüre aus dem Ersten Weltkrieg ist es nach hundert Jahren egal, ob jemand in den ersten Wochen gestorben ist, wie Georg Trakl 1914 in Grodek, oder im zweiten Jahr der Katastrophe, wie August Stramm 1915 am Dnjepr-Bug-Kanal.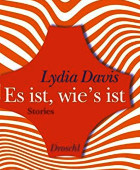 Eine einzige gelungene Shortstory ist schon aufregend wie das Gesamtwerk einer Künstlerin, zeigt sie doch auf engstem Raum jeweils eine zentrale Thematik, eine solitäre Erzähltechnik und eine konnotierte Lebenserfahrung. Lydia Davis erfüllt diese Kriterien in beinahe jeder ihrer Geschichten, und manchmal setzt sie dazu neue Maßstäbe, wie in der ersten Geschichte des Bandes „Es ist, wie’s ist“.
Eine einzige gelungene Shortstory ist schon aufregend wie das Gesamtwerk einer Künstlerin, zeigt sie doch auf engstem Raum jeweils eine zentrale Thematik, eine solitäre Erzähltechnik und eine konnotierte Lebenserfahrung. Lydia Davis erfüllt diese Kriterien in beinahe jeder ihrer Geschichten, und manchmal setzt sie dazu neue Maßstäbe, wie in der ersten Geschichte des Bandes „Es ist, wie’s ist“. Sagen sind das, was die Leute über die Jahrhunderte sagen. Diese witzige Definition erfreut zwar nicht das Fachpublikum, erklärt aber, dass Sagen nie fertig sind und in jeder Generation neu erzählt werden müssen. Und wenn es einmal keine Sagen mehr geben sollte, werden auch die Leute nichts mehr sagen, weil sie ausgestorben sind.
Sagen sind das, was die Leute über die Jahrhunderte sagen. Diese witzige Definition erfreut zwar nicht das Fachpublikum, erklärt aber, dass Sagen nie fertig sind und in jeder Generation neu erzählt werden müssen. Und wenn es einmal keine Sagen mehr geben sollte, werden auch die Leute nichts mehr sagen, weil sie ausgestorben sind.