Johannes Twaroch, Stilles Strömen der Zeit
 Während die große Literatur wie massive Brückenpfeiler in das wilde Wasser der Gegenwart gerammt ist, sind die Miniaturen am ehesten mit dem Fugenkitt rund um wasserdichte Erlebnis-Elemente zu vergleichen.
Während die große Literatur wie massive Brückenpfeiler in das wilde Wasser der Gegenwart gerammt ist, sind die Miniaturen am ehesten mit dem Fugenkitt rund um wasserdichte Erlebnis-Elemente zu vergleichen.
Johannes Twaroch nennt seine Kurzprosa stilles Strömen der Zeit, unter der großen Fläche von Weltnachrichten perlen immer diese Minutentexte hervor, oft nur bemerkbar, wenn man als Leser eine Auszeit nimmt, und sei es für Minuten.

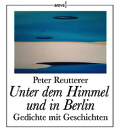 Filmtitel sind oft für eine Epoche so prägend, dass ihre Schlüsselwörter sich wie ein visueller Ohrwurm in den Zeitgenossen festsetzen. „Der Himmel über Berlin“ überstrahlt seit 1987 als poetische Äußerung alles, was mit Himmel und Berlin zusammenhängen könnte.
Filmtitel sind oft für eine Epoche so prägend, dass ihre Schlüsselwörter sich wie ein visueller Ohrwurm in den Zeitgenossen festsetzen. „Der Himmel über Berlin“ überstrahlt seit 1987 als poetische Äußerung alles, was mit Himmel und Berlin zusammenhängen könnte. Dieser seltsame Zustand „zwischen“, quasi nicht Fisch und nicht Fleisch, oder „eingeklemmt“ wie es der Lyriker N.C. Kaser einmal genant hat, gilt am Kontinent als österreichische Kernmentalität: Nicht anstreifen, nicht dabei sein, nicht Farbe bekennen.
Dieser seltsame Zustand „zwischen“, quasi nicht Fisch und nicht Fleisch, oder „eingeklemmt“ wie es der Lyriker N.C. Kaser einmal genant hat, gilt am Kontinent als österreichische Kernmentalität: Nicht anstreifen, nicht dabei sein, nicht Farbe bekennen.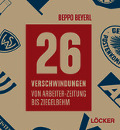 Da sucht man als Leser jahrelang einen Begriff für jene Dinge, die noch fragmentarisch in der Erinnerung da sind, aber im öffentlichen Leben schon verschwunden sind, und da kommt glücklicherweise Beppo Beyerl daher und hat ihn: Verschwindung.
Da sucht man als Leser jahrelang einen Begriff für jene Dinge, die noch fragmentarisch in der Erinnerung da sind, aber im öffentlichen Leben schon verschwunden sind, und da kommt glücklicherweise Beppo Beyerl daher und hat ihn: Verschwindung.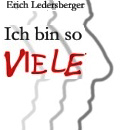 In einer Gesellschaft, wo das Vermehren von Kapital als das Non-plus-Ultra des Lebensglückes gilt, versuchen es einige auch mit dem Vermehren der eigenen Identitäten.
In einer Gesellschaft, wo das Vermehren von Kapital als das Non-plus-Ultra des Lebensglückes gilt, versuchen es einige auch mit dem Vermehren der eigenen Identitäten.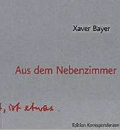 Es ist wie beim berühmten Stein, den man am Wegrand kurz wegdreht, und darunter tummelt sich ein Kosmos von Getier in voller Bewegung.
Es ist wie beim berühmten Stein, den man am Wegrand kurz wegdreht, und darunter tummelt sich ein Kosmos von Getier in voller Bewegung.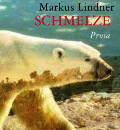 Bei der Schmelze verändert sich der Stoff und geht vom festen in den flüssigen Aggregatszustand über. Auch in der Poesie gibt es so etwas wie Schmelze, wenn sich ein Stoff während des Erzählens verändert und als Prosa-Lava über die Seiten fließt.
Bei der Schmelze verändert sich der Stoff und geht vom festen in den flüssigen Aggregatszustand über. Auch in der Poesie gibt es so etwas wie Schmelze, wenn sich ein Stoff während des Erzählens verändert und als Prosa-Lava über die Seiten fließt.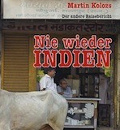 So wie man eine Reise antritt, so wird sie auch ausfallen. Am aufmerksamsten reist, wer eine Reise nur einmal machen möchte.
So wie man eine Reise antritt, so wird sie auch ausfallen. Am aufmerksamsten reist, wer eine Reise nur einmal machen möchte.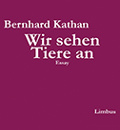 Wenn Tiere mehr als eine Sache aber weniger als ein Mensch sind, muss folglich auch unser Blick auf sie heftiger als auf Sachen aber weniger intensiv als auf Menschen ausfallen.
Wenn Tiere mehr als eine Sache aber weniger als ein Mensch sind, muss folglich auch unser Blick auf sie heftiger als auf Sachen aber weniger intensiv als auf Menschen ausfallen.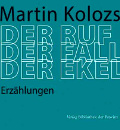 Der literaturgeschliffene Blick wird hinter der Begriffskette „Ruf-Fall-Ekel“ gleich ein Stück Literaturgeschichte aus den 1940er und 1950er Jahren erkennen. Die kulturpolitische Zeitschrift „Der Ruf“ versammelte rund um Alfred Andersch die verstümmelten Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg, „Der Fall“ (1956) von Albert Camus zeigt anhand eines Absturzes des Helden die Zerbrechlichkeit einer Utopie, und Jean-Paul Sartres „Der Ekel“ (1938) gilt überhaupt als das Hauptwerk des Existentialismus.
Der literaturgeschliffene Blick wird hinter der Begriffskette „Ruf-Fall-Ekel“ gleich ein Stück Literaturgeschichte aus den 1940er und 1950er Jahren erkennen. Die kulturpolitische Zeitschrift „Der Ruf“ versammelte rund um Alfred Andersch die verstümmelten Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg, „Der Fall“ (1956) von Albert Camus zeigt anhand eines Absturzes des Helden die Zerbrechlichkeit einer Utopie, und Jean-Paul Sartres „Der Ekel“ (1938) gilt überhaupt als das Hauptwerk des Existentialismus.