Rudolf Habringer, Leirichs Zögern
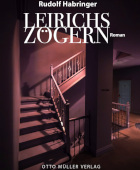 Eine besonders spektakuläre Art, sein Leben in Aufruhr zu bringen, ist dessen Sedierung durch wohl einstudierte Handgriffe des Alltags und Rituale, die regelmäßig ins Leere führen.
Eine besonders spektakuläre Art, sein Leben in Aufruhr zu bringen, ist dessen Sedierung durch wohl einstudierte Handgriffe des Alltags und Rituale, die regelmäßig ins Leere führen.
Rudolf Habringer stellt einen Helden vor, der mitten in seiner eigenen Ordnung zu versickern droht. Gregor Leirich ist Zeitgeschichtler an einem Universitätsinstitut, wo sich selbst die Gegenwart bereits in eine vorsortierte Materie verwandelt hat, sodass man ohne Aufregung daran herumforschen kann. Der Schwerpunkt liegt ohnehin bei der Produktion von Bachelors, wodurch der Lauf der Geschichte für die nächste Generation gesichert zu sein scheint. Das alles entscheidende Wort heißt „vorsatzgemäß“. Der gute Historiker steht früh am Morgen auf und hat einen Plan, den er nach seinen Vorstellungen als Tagwerk abarbeiten wird.

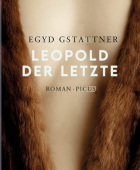 Kann man aus dem Jenseits heraus einen Roman schreiben? ‒ Diese Frage beschäftigt das Publikum schon seit Jahrhunderten. Die Sache ist so fragwürdig heiß, dass man nicht von ihr ablassen kann, ehe der Roman fertig gelesen ist.
Kann man aus dem Jenseits heraus einen Roman schreiben? ‒ Diese Frage beschäftigt das Publikum schon seit Jahrhunderten. Die Sache ist so fragwürdig heiß, dass man nicht von ihr ablassen kann, ehe der Roman fertig gelesen ist. „Wir leben hier. In diesem Tal. Wir sind ebenfalls keine Idioten. Und wir langweilen uns nicht. ‒ Manchmal vielleicht ein kleines bisschen.“ (120) Diese Beschreibung eines entlegenen Landstrichs von Amerika ist vielleicht das genaue Gegenteil von Tirol und heizt dadurch unsere Sehnsucht an.
„Wir leben hier. In diesem Tal. Wir sind ebenfalls keine Idioten. Und wir langweilen uns nicht. ‒ Manchmal vielleicht ein kleines bisschen.“ (120) Diese Beschreibung eines entlegenen Landstrichs von Amerika ist vielleicht das genaue Gegenteil von Tirol und heizt dadurch unsere Sehnsucht an.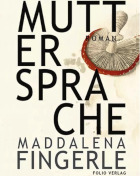 Zwei Südtiroler Autorinnen mischen die Südtiroler Literaturszene auf wie bislang vielleicht n. c. kaser mit seiner berüchtigten Brixner Rede 1969, als er über die verlogenen Literaturbetreiber und andere Sprachwurschtl in Südtirol herzieht.
Zwei Südtiroler Autorinnen mischen die Südtiroler Literaturszene auf wie bislang vielleicht n. c. kaser mit seiner berüchtigten Brixner Rede 1969, als er über die verlogenen Literaturbetreiber und andere Sprachwurschtl in Südtirol herzieht.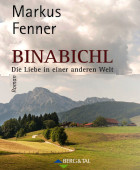 Wenn der Titel eines Romans grotesk-witzig genug ist, musst du dein Leben unterbrechen und darin zu lesen beginnen. „Bin-a-Bichl“ ist sprachlich gleich gestaltet wie das häufig verwendete „Bin-a-Trottl“, womit gesagt ist: Endlich einmal beginnt ein geographischer Haufen aus sich heraus zu sprechen!
Wenn der Titel eines Romans grotesk-witzig genug ist, musst du dein Leben unterbrechen und darin zu lesen beginnen. „Bin-a-Bichl“ ist sprachlich gleich gestaltet wie das häufig verwendete „Bin-a-Trottl“, womit gesagt ist: Endlich einmal beginnt ein geographischer Haufen aus sich heraus zu sprechen!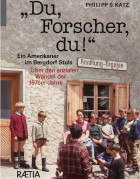 Was waren das noch für Zeiten, als Forschern nicht nur geglaubt wurde, was sie erforschten, sondern als man sie auch noch unterstützte und als fröhliche Wissenskumpane begrüßte.
Was waren das noch für Zeiten, als Forschern nicht nur geglaubt wurde, was sie erforschten, sondern als man sie auch noch unterstützte und als fröhliche Wissenskumpane begrüßte. Bald wird die Erde so vermüllt sein, dass es keinen Flecken mehr gibt, auf dem man ein Selfie mit unberührter Natur machen kann. Auch die Literatur leidet schon unter dem Mangel an unberührten Plätzen, worin sich die Seele in sich selbst austoben kann. Als letzte Refugien für kranke Psychen gelten Patagonien und Spitzbergen. Das früher weit verbreitete Sibirien ist ja momentan sanktioniert.
Bald wird die Erde so vermüllt sein, dass es keinen Flecken mehr gibt, auf dem man ein Selfie mit unberührter Natur machen kann. Auch die Literatur leidet schon unter dem Mangel an unberührten Plätzen, worin sich die Seele in sich selbst austoben kann. Als letzte Refugien für kranke Psychen gelten Patagonien und Spitzbergen. Das früher weit verbreitete Sibirien ist ja momentan sanktioniert.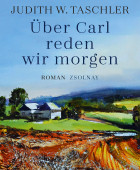 Je katastrophaler die Gegenwart empfunden wird, umso mehr weichen Romane in die Vergangenheit aus. Eine Familiengeschichte, die kurz nach dem ersten Weltkrieg aufhört, beruhigt aufgewühlte Pandemie- und Kriegsseelen gleichermaßen.
Je katastrophaler die Gegenwart empfunden wird, umso mehr weichen Romane in die Vergangenheit aus. Eine Familiengeschichte, die kurz nach dem ersten Weltkrieg aufhört, beruhigt aufgewühlte Pandemie- und Kriegsseelen gleichermaßen.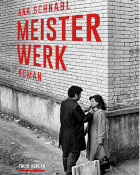 Zwischen Literatur und Geschichte herrscht immer ein unausgesprochenes Wechselspiel. Zum einen vermag die Literatur gesellschaftliche Umbrüche voranzutreiben oder zu verhindern, zum anderen werden in Zeiten des Umbruchs selbst intime Liebesgeschichten zu einem Politikum.
Zwischen Literatur und Geschichte herrscht immer ein unausgesprochenes Wechselspiel. Zum einen vermag die Literatur gesellschaftliche Umbrüche voranzutreiben oder zu verhindern, zum anderen werden in Zeiten des Umbruchs selbst intime Liebesgeschichten zu einem Politikum.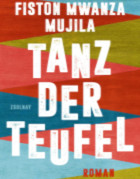 Manchmal erzählt sich ein Roman von selbst, indem er sich zu Beginn als Stück Landkarte zeigt, worin alles eine Stimme hat. Schon das erste Abtasten dieser Karte mit einem kalten Lesefinger lässt den Text aufwallen: Hier erzählen Hitze, aufsteigende Blasen, wabernde Lava, einstürzende Minen und aufgewühlte Menschen von der Geschichte der Kolonialisierung und um ihr Leben.
Manchmal erzählt sich ein Roman von selbst, indem er sich zu Beginn als Stück Landkarte zeigt, worin alles eine Stimme hat. Schon das erste Abtasten dieser Karte mit einem kalten Lesefinger lässt den Text aufwallen: Hier erzählen Hitze, aufsteigende Blasen, wabernde Lava, einstürzende Minen und aufgewühlte Menschen von der Geschichte der Kolonialisierung und um ihr Leben.