Phil Klay, Den Sturm ernten
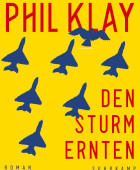 Am Cover jagen acht Kampfjets einen Vogel, der aus dem Bild zu flüchten trachtet. Die blauen Flugkörper huschen über einen gelben Grund, und beides erinnert an die ukrainische Fahne, die stets an der Kriegsgrenze auf und ab getragen wird.
Am Cover jagen acht Kampfjets einen Vogel, der aus dem Bild zu flüchten trachtet. Die blauen Flugkörper huschen über einen gelben Grund, und beides erinnert an die ukrainische Fahne, die stets an der Kriegsgrenze auf und ab getragen wird.
Phil Klay nennt seinen Kriegsweltroman „Den Sturm ernten“. Diesen hat offensichtlich schon jemand erfolgreich gesät. Der Schauplatz ist jene Welt, die eine Weltmacht für ihre Kriege braucht, denn über allen Strategien steht ein Zitat des französischen Staatsmanns Léon Gambetta: „Um eine große Nation zu bleiben oder um eine zu werden, muss man kolonisieren.“ (473)

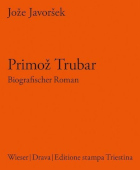 Damit sich ein Staat gegenüber anderen Staaten legitimieren kann, braucht er neben Fahnen, Verfassung, Verteidigung und Währung auch den Nachweis, dass er lesen und schreiben kann. Ursprünglich mussten nur Kirchenleute und Kriegsherrn nachweisen, dass sie zumindest Urkunden lesen können, in demokratisch organisierten Gebilden ist es unumgänglich, dass es auch eine Literatur gibt, die aus dem Volk für das Volk gemacht wird.
Damit sich ein Staat gegenüber anderen Staaten legitimieren kann, braucht er neben Fahnen, Verfassung, Verteidigung und Währung auch den Nachweis, dass er lesen und schreiben kann. Ursprünglich mussten nur Kirchenleute und Kriegsherrn nachweisen, dass sie zumindest Urkunden lesen können, in demokratisch organisierten Gebilden ist es unumgänglich, dass es auch eine Literatur gibt, die aus dem Volk für das Volk gemacht wird.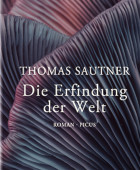 Schöpfungsgeschichten haben meist einen Prolog, in dem das Wesentliche erzählt wird. Bei der Erschaffung der Welt geht es nämlich wie in der Genesis darum, dass zuerst nichts ist, und dann durch einen Erzähltrick plötzlich die komplette Welt eruptiert. In der Bibel funktioniert das mit dem Satz vom „Anfang war das Wort“, beim Faust mit der Sonne, die nach alter Weise kreist, im Taoismus beginnt die Welt als mathematische Formel, wonach die Eins die Zwei hervorbringt.
Schöpfungsgeschichten haben meist einen Prolog, in dem das Wesentliche erzählt wird. Bei der Erschaffung der Welt geht es nämlich wie in der Genesis darum, dass zuerst nichts ist, und dann durch einen Erzähltrick plötzlich die komplette Welt eruptiert. In der Bibel funktioniert das mit dem Satz vom „Anfang war das Wort“, beim Faust mit der Sonne, die nach alter Weise kreist, im Taoismus beginnt die Welt als mathematische Formel, wonach die Eins die Zwei hervorbringt.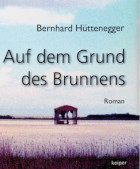 In alten Märchenbildern ist die Welt wie eine Sanduhr aus Sternen aufgebaut. Wer in die Tiefe eines Brunnens blickt, sieht darin die Sterne des Firmaments gespiegelt, wer in den Himmel schaut, wird in die Tiefe hinabgezogen wie in einen Brunnen.
In alten Märchenbildern ist die Welt wie eine Sanduhr aus Sternen aufgebaut. Wer in die Tiefe eines Brunnens blickt, sieht darin die Sterne des Firmaments gespiegelt, wer in den Himmel schaut, wird in die Tiefe hinabgezogen wie in einen Brunnen.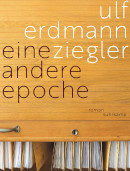 Staatstragende Romane sollten wenigstens zehn Jahre lang warten, ehe sie eine Gegenwart historisch abgekühlte beschreiben. Alles, was zu nahe an den aktuellen Kalender herangeführt ist, klingt nach Wahlkampf, Propaganda oder Streitschrift.
Staatstragende Romane sollten wenigstens zehn Jahre lang warten, ehe sie eine Gegenwart historisch abgekühlte beschreiben. Alles, was zu nahe an den aktuellen Kalender herangeführt ist, klingt nach Wahlkampf, Propaganda oder Streitschrift.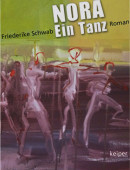 In der Literatur schaffen es nur wenige Titel, dass schon bei ihrer Erwähnung sofort ein Stück Lebensprogramm aufpoppt. „Faust“, „Das Schloss“, „Verstörung“ lassen nicht nur einen Text in der Lese-Erinnerung hochschnellen, sie zeigen in einem einzigen Aufblitzen Helden, die um ihr Schicksal ringen. Aus feministischer Sicht sind solche Highlights etwa „Madame Bovary“, „Pippi Langstrumpf“ oder eben „Nora“.
In der Literatur schaffen es nur wenige Titel, dass schon bei ihrer Erwähnung sofort ein Stück Lebensprogramm aufpoppt. „Faust“, „Das Schloss“, „Verstörung“ lassen nicht nur einen Text in der Lese-Erinnerung hochschnellen, sie zeigen in einem einzigen Aufblitzen Helden, die um ihr Schicksal ringen. Aus feministischer Sicht sind solche Highlights etwa „Madame Bovary“, „Pippi Langstrumpf“ oder eben „Nora“.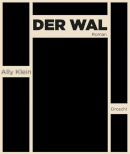 Warum sind manche Romane gegliedert und andere eine einzige Textwurst? – Beides zeigt das Ringen der Autoren um das Publikum. Manche versteigen sich dabei in Gegenden, wo es nichts mehr zu erklären, deuten oder gliedern gibt. Nicht so beim „Wal“, hier wird das Unbeschreibliche in ein überschaubares Erzählkonzept gegossen.
Warum sind manche Romane gegliedert und andere eine einzige Textwurst? – Beides zeigt das Ringen der Autoren um das Publikum. Manche versteigen sich dabei in Gegenden, wo es nichts mehr zu erklären, deuten oder gliedern gibt. Nicht so beim „Wal“, hier wird das Unbeschreibliche in ein überschaubares Erzählkonzept gegossen.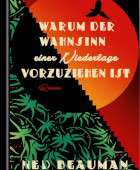 Lässt sich das große Amerika besser würdigen, wenn man einen Hollywood-Film mit voller Dramaturgie im Dschungel dreht und dabei einen Maya-Tempel als Kulisse missbraucht, oder ist es gleich besser, diese Pyramide abzutragen und missbräuchlich in New York aufzustellen?
Lässt sich das große Amerika besser würdigen, wenn man einen Hollywood-Film mit voller Dramaturgie im Dschungel dreht und dabei einen Maya-Tempel als Kulisse missbraucht, oder ist es gleich besser, diese Pyramide abzutragen und missbräuchlich in New York aufzustellen? Utopien und Dystopien müssen den Leser mit zwei Brechstangen öffnen und bearbeiten, einmal ist es eine utopische Botschaft in Romanform, zum anderen das Aushebeln der Zeit.
Utopien und Dystopien müssen den Leser mit zwei Brechstangen öffnen und bearbeiten, einmal ist es eine utopische Botschaft in Romanform, zum anderen das Aushebeln der Zeit.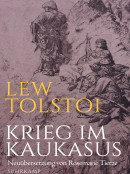 Tourismus und Krieg sind die Triebfedern dafür, dass wir uns zwischendurch für die Literatur scheinbar entlegener Gegenden interessieren. Manche halten den Tourismus für eine Sonderform des Krieges, was die Lesemotivation noch einmal vereinfacht. Am liebsten sind uns dabei Dinge, die uns schon vertraut sind.
Tourismus und Krieg sind die Triebfedern dafür, dass wir uns zwischendurch für die Literatur scheinbar entlegener Gegenden interessieren. Manche halten den Tourismus für eine Sonderform des Krieges, was die Lesemotivation noch einmal vereinfacht. Am liebsten sind uns dabei Dinge, die uns schon vertraut sind.