Alfred J. Noll, Wie das Recht in die Welt kommt
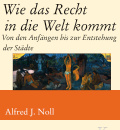 „Wer will heute noch über das Recht diskutieren, Argumente auf ihre Prämissen überprüfen, Lebenszeit verausgaben, um nach Gründen für Recht und nach Gründen des Rechts zu suchen. Vom Recht ist nicht mehr die Rede, alle Welt ist nur noch an Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, Erlässen, Bescheiden, Urteilen und Weisungen interessiert. Es gibt keine Vorstellung von der notwendigen Differenz zwischen Ideal und Praxis.“ (S. 7)
„Wer will heute noch über das Recht diskutieren, Argumente auf ihre Prämissen überprüfen, Lebenszeit verausgaben, um nach Gründen für Recht und nach Gründen des Rechts zu suchen. Vom Recht ist nicht mehr die Rede, alle Welt ist nur noch an Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen, Erlässen, Bescheiden, Urteilen und Weisungen interessiert. Es gibt keine Vorstellung von der notwendigen Differenz zwischen Ideal und Praxis.“ (S. 7)
Den Gründen und Ursachen des Rechts auf die Spur zu gehen und die Differenz zwischen Ideal und Praxis aufzuzeigen macht sich Alfred Noll in einem Abriss durch die Geschichte des Rechts auf den Weg. Dabei zeigt er detailliert und anhand zahlreicher Beispiele, wie sich die Vorstellung und Umsetzung von Recht von der steinzeitlichen Welt der Nomaden bis in die Zeit komplexer Städtestrukturen gewandelt hat.

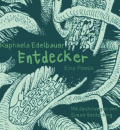 Im Idealfall gleicht ein Buch dem ersten Lesebuch, das einem damals die Welt erschlossen hat. Man wird als Leser jung, neugierig, zukunftsfroh und vollends optimistisch, dass da etwas drinnen steht, was man sofort und für alle Zeit gebrauchen kann.
Im Idealfall gleicht ein Buch dem ersten Lesebuch, das einem damals die Welt erschlossen hat. Man wird als Leser jung, neugierig, zukunftsfroh und vollends optimistisch, dass da etwas drinnen steht, was man sofort und für alle Zeit gebrauchen kann.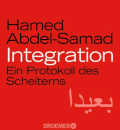 „Überspitzt formuliert könnte man sagen: Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten, sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18)
„Überspitzt formuliert könnte man sagen: Nach all den Bemühungen, Konferenzen und Integrationsprojekten, sind vor allem der politische Islam und die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“ (S. 18)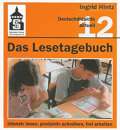 „Obwohl die Lesefähigkeit und –bereitschaft von Schülerinnen und Schülern in jeder Altersstufe entfaltungs- und ausbaufähig seien, sehe es eher so aus, als ob der Deutschunterricht vielen die Lust am Lesen austreibe, anstatt ihnen Freude an Literatur zu vermitteln. Oft scheine geradezu das Gegenteil dessen bewirkt zu werden, was eigentlich erreicht werden solle …“ (1)
„Obwohl die Lesefähigkeit und –bereitschaft von Schülerinnen und Schülern in jeder Altersstufe entfaltungs- und ausbaufähig seien, sehe es eher so aus, als ob der Deutschunterricht vielen die Lust am Lesen austreibe, anstatt ihnen Freude an Literatur zu vermitteln. Oft scheine geradezu das Gegenteil dessen bewirkt zu werden, was eigentlich erreicht werden solle …“ (1)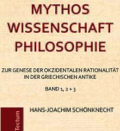 „In der ersten Hälfte des 6. Jh. v. Chr. ereignete sich in einer Küstenstadt Groß-Griechenlands ein Vorgang von weitreichender, ja man darf sagen: von welthistorischer Bedeutung, »eine geistesgeschichtliche Revolution unerhörten Ausmaßes« deren Auswirkungen allerdings erst mehr als zweitausend Jahre später zu voller Geltung kommen.“ (Bd. 1, S. 13)
„In der ersten Hälfte des 6. Jh. v. Chr. ereignete sich in einer Küstenstadt Groß-Griechenlands ein Vorgang von weitreichender, ja man darf sagen: von welthistorischer Bedeutung, »eine geistesgeschichtliche Revolution unerhörten Ausmaßes« deren Auswirkungen allerdings erst mehr als zweitausend Jahre später zu voller Geltung kommen.“ (Bd. 1, S. 13) Beim Vorlesen lässt sich oft schwer feststellen, wer den größeren Genuss hat. Ist es die vorlesende Person oder die lauschende? Ähnliches passiert beim Erinnern, wer hat den größeren Nutzen? Jemand, der durch das Erinnern mit sich selbst ins Reine kommt, oder jemand, der durch die erinnerte Geschichte mit einer anderen Welt vertraut gemacht wird?
Beim Vorlesen lässt sich oft schwer feststellen, wer den größeren Genuss hat. Ist es die vorlesende Person oder die lauschende? Ähnliches passiert beim Erinnern, wer hat den größeren Nutzen? Jemand, der durch das Erinnern mit sich selbst ins Reine kommt, oder jemand, der durch die erinnerte Geschichte mit einer anderen Welt vertraut gemacht wird?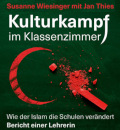 „Die Lehrerin Susanne Wiesinger bietet mir ihrem Buch einen Debattenbeitrag an, denn sie hat gemerkt, dass der Islam die Alltagswelt vieler muslimischer Schülerinnen und Schüler in Österreich sehr stark dominiert. In den Schulen herrscht ein Wertekonflikt …“ (S. 6)
„Die Lehrerin Susanne Wiesinger bietet mir ihrem Buch einen Debattenbeitrag an, denn sie hat gemerkt, dass der Islam die Alltagswelt vieler muslimischer Schülerinnen und Schüler in Österreich sehr stark dominiert. In den Schulen herrscht ein Wertekonflikt …“ (S. 6) „Gewiss, alles deutete längst darauf hin, dass es sich um einen kostbaren Fund handelt, allein die schiere Masse der Briefe, dieser dicke Stapel an Handschriften. Fast alles aus einer Feder! Aber dass es sich um längst vergessene Briefe von Maria Theresia, der einzigen Frau auf Habsburgs Thron, an die Mutter jenes Patenkindes handelt, ist eine Sensation, ein Geschenk des Zufalls …“ (S. 8)
„Gewiss, alles deutete längst darauf hin, dass es sich um einen kostbaren Fund handelt, allein die schiere Masse der Briefe, dieser dicke Stapel an Handschriften. Fast alles aus einer Feder! Aber dass es sich um längst vergessene Briefe von Maria Theresia, der einzigen Frau auf Habsburgs Thron, an die Mutter jenes Patenkindes handelt, ist eine Sensation, ein Geschenk des Zufalls …“ (S. 8)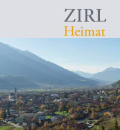 Als die heikelste Form, etwas zu erzählen, gilt jene, es über das Heimat-Buch zu betreiben. In seinem Heimatort nämlich ist jeder ein großer Erzähler, aber es gibt kaum Zuhörer. So löst ein Heimat-Buch immer große Diskussionen aus, ob auch alle Geschichten drin sind, ob sie richtig erzählt sind, ob die Namen richtig gedruckt sind und vor allem, ob auch niemand vergessen worden ist.
Als die heikelste Form, etwas zu erzählen, gilt jene, es über das Heimat-Buch zu betreiben. In seinem Heimatort nämlich ist jeder ein großer Erzähler, aber es gibt kaum Zuhörer. So löst ein Heimat-Buch immer große Diskussionen aus, ob auch alle Geschichten drin sind, ob sie richtig erzählt sind, ob die Namen richtig gedruckt sind und vor allem, ob auch niemand vergessen worden ist. Was das Familienalbum für die Angehörigen ist, ist der Architekturführer für die Stadtbewohner. Hier können die Zeitgenossen jeweils nachschauen, wie die Geliebten und Geschätzten beisammen sind. Denn Gebäude sind nicht nur die dritte Haut des Menschen, sondern auch ein Gegenüber, mit dem man diskutiert, indem man es betritt.
Was das Familienalbum für die Angehörigen ist, ist der Architekturführer für die Stadtbewohner. Hier können die Zeitgenossen jeweils nachschauen, wie die Geliebten und Geschätzten beisammen sind. Denn Gebäude sind nicht nur die dritte Haut des Menschen, sondern auch ein Gegenüber, mit dem man diskutiert, indem man es betritt.