Andreas Koller, Journalismus. Macht. Wirklichkeit
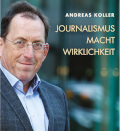 Wo ist eigentlich Krieg? - Dort wo der Wehrschütz ist. Dieser Witz über die Kriegsberichterstattung des ORF zeigt das Dilemma des modernen Journalismus. Nachrichten entstehen nur mehr dort, wo jemand das Geld hat, jemanden hinzuschicken, oder im Netz, wo alles eine Nachricht ist.
Wo ist eigentlich Krieg? - Dort wo der Wehrschütz ist. Dieser Witz über die Kriegsberichterstattung des ORF zeigt das Dilemma des modernen Journalismus. Nachrichten entstehen nur mehr dort, wo jemand das Geld hat, jemanden hinzuschicken, oder im Netz, wo alles eine Nachricht ist.
Andreas Koller geht 2016 in seiner „Theodor-Herzl-Vorlesung“ an der Uni Wien nicht nur diesen Witzen auf den Grund, er versucht anhand der Groß-Begriffe Zeitgeist, Moral und Politik eine Lanze für den klassischen Journalismus zu brechen, der sich momentan fast täglich rechtfertigen muss.

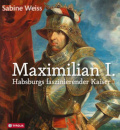 „Am 12. Januar 2019 jährt sich zum 500. Mal der Todestag Kaiser Maximilians I. Wer war dieser Herrscher? Ist es gerechtfertigt, seiner noch nach einem halben Jahrtausend zu gedenken? Ja, denn Maximilian war eine faszinierende Persönlichkeit: stets voller Ideen und Pläne, mit ritterliche Idealen, ein arbeitsamer Herrscher, schriftstellerisch tätig, ein Liebhaber der Musik, der Frauen und der Natur, mutig bis zur Waghalsigkeit, aber auch kriegslüstern, ehr- und ruhmsüchtig.“ (7)
„Am 12. Januar 2019 jährt sich zum 500. Mal der Todestag Kaiser Maximilians I. Wer war dieser Herrscher? Ist es gerechtfertigt, seiner noch nach einem halben Jahrtausend zu gedenken? Ja, denn Maximilian war eine faszinierende Persönlichkeit: stets voller Ideen und Pläne, mit ritterliche Idealen, ein arbeitsamer Herrscher, schriftstellerisch tätig, ein Liebhaber der Musik, der Frauen und der Natur, mutig bis zur Waghalsigkeit, aber auch kriegslüstern, ehr- und ruhmsüchtig.“ (7) „Angesichts dieser Text-, Medien- und Informationsvielfalt ist der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur kaum mehr zu überschauen. In Studium und Unterricht stellen sich deshalb häufig die Fragen: Welche neueren Texte eignen sich für die Diskussion im Seminar oder für das literarische Lernen im Deutschunterricht der unterschiedlichen Schulformen und Jahrgangsstufen?“ (S. 9)
„Angesichts dieser Text-, Medien- und Informationsvielfalt ist der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur kaum mehr zu überschauen. In Studium und Unterricht stellen sich deshalb häufig die Fragen: Welche neueren Texte eignen sich für die Diskussion im Seminar oder für das literarische Lernen im Deutschunterricht der unterschiedlichen Schulformen und Jahrgangsstufen?“ (S. 9) „Jeder kann zeichnen und Kategorien wie richtig und falsch gelten hier nicht. Kinder stehen sich nicht mit Zweifeln selbst im Weg. Aber auch Erwachsene können mit derselben Freude zeichnen, wenn sie wissen, wie sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern können.“ (S. 10)
„Jeder kann zeichnen und Kategorien wie richtig und falsch gelten hier nicht. Kinder stehen sich nicht mit Zweifeln selbst im Weg. Aber auch Erwachsene können mit derselben Freude zeichnen, wenn sie wissen, wie sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern können.“ (S. 10)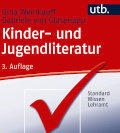 „Der vorliegende Band bietet auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes eine historische und systematische Aspekte verbindende Einführung in einen Teilbereich der Literatur, der per se keineswegs ein »Lernfeld« des Deutschunterrichts darstellt. Kinder- und Jugendbücher sind zunächst einmal Gegenstände der Freizeitliteratur.“ (13f)
„Der vorliegende Band bietet auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes eine historische und systematische Aspekte verbindende Einführung in einen Teilbereich der Literatur, der per se keineswegs ein »Lernfeld« des Deutschunterrichts darstellt. Kinder- und Jugendbücher sind zunächst einmal Gegenstände der Freizeitliteratur.“ (13f)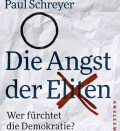 „Quer durch die Geschichte zieht sich der Streit, wer in der Gesellschaft das Sagen haben soll. Ob in Antike, Mittelalter, 20. Jahrhundert oder heute: Immer wieder aufs Neue stellt sich die Frage nach der Macht im Staate und die nach der Gerechtigkeit. Sollen die Reichen, die »Experten«, die »Klugen« entscheiden – oder soll die Politik tatsächlich von allen bestimmt werden?“
„Quer durch die Geschichte zieht sich der Streit, wer in der Gesellschaft das Sagen haben soll. Ob in Antike, Mittelalter, 20. Jahrhundert oder heute: Immer wieder aufs Neue stellt sich die Frage nach der Macht im Staate und die nach der Gerechtigkeit. Sollen die Reichen, die »Experten«, die »Klugen« entscheiden – oder soll die Politik tatsächlich von allen bestimmt werden?“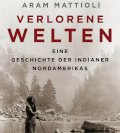 „Die beinahe vollständige Ausrottung der First People gehört zu den zentralen Vorgängen der amerikanischen Geschichte. Zusammen mit dem Kollaps der indianischen Kulturen in Mittel- und Südamerika zählt sie zu den großen Menschheitskatastrophen vor dem 20. Jahrhundert. Das Ausmaß der Zerstörung lässt sich kaum in Worte fassen und auch durch nackte Zahlen nur andeuten ...“ (15)
„Die beinahe vollständige Ausrottung der First People gehört zu den zentralen Vorgängen der amerikanischen Geschichte. Zusammen mit dem Kollaps der indianischen Kulturen in Mittel- und Südamerika zählt sie zu den großen Menschheitskatastrophen vor dem 20. Jahrhundert. Das Ausmaß der Zerstörung lässt sich kaum in Worte fassen und auch durch nackte Zahlen nur andeuten ...“ (15) „Von der Montanunion zur Europäischen Union. - Nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges ist der Wunsch nach einer Einigung Europas groß. Die Politiker haben verstanden, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, als gegeneinander zu arbeiten und zu kämpfen.“ (1)
„Von der Montanunion zur Europäischen Union. - Nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges ist der Wunsch nach einer Einigung Europas groß. Die Politiker haben verstanden, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, als gegeneinander zu arbeiten und zu kämpfen.“ (1)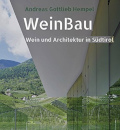 Die beiden wichtigsten Kulturtätigkeiten Südtirols sind nach allgemeiner Lesart die Kultivierung von Wein und das Bauen in der Landschaft.
Die beiden wichtigsten Kulturtätigkeiten Südtirols sind nach allgemeiner Lesart die Kultivierung von Wein und das Bauen in der Landschaft.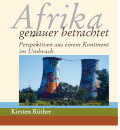 „Über den Schritt, Altbekanntes und Wohlvertrautes zu wiederholen und neu zuzuspitzen, soll dieses Buch hinausgehen. In erster Linie sollen womöglich vage geläufigen Themengegenständen, die unter das große Etikett »Afrika« fallen, mehr Dimensionen hinzugefügt werden.“ (10)
„Über den Schritt, Altbekanntes und Wohlvertrautes zu wiederholen und neu zuzuspitzen, soll dieses Buch hinausgehen. In erster Linie sollen womöglich vage geläufigen Themengegenständen, die unter das große Etikett »Afrika« fallen, mehr Dimensionen hinzugefügt werden.“ (10)