Stefan Winterstein, Früher war mehr Rechtschreibung
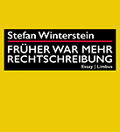 Menschen, die sich um Rechtschreibung kümmern, werden zwischendurch scheel angeschaut, weil sie entweder kleinkarierte Pipis oder heimliche Machtmenschen sind. Exzessives Rechtschreiben wird oft aus Gründen einer psychischen Störung bei sich selbst oder aus Disziplinierungsgründen bei anderen eingesetzt.
Menschen, die sich um Rechtschreibung kümmern, werden zwischendurch scheel angeschaut, weil sie entweder kleinkarierte Pipis oder heimliche Machtmenschen sind. Exzessives Rechtschreiben wird oft aus Gründen einer psychischen Störung bei sich selbst oder aus Disziplinierungsgründen bei anderen eingesetzt.
Stefan Winterstein stellt mit seinem Essay solchen landläufigen Meinungen Einiges an Ordnung und Aufklärung entgegen. Obwohl der Essay völlig freien Formen huldigen darf, teilt ihn der Autor klug in drei Kapitel ein und formuliert die Thesen mit der Präzision eines Wittgensteinschen Zählwerks. A erzählt alles Notwendige über die Rechtschreibung, in B werden psychologische Schrullen der Anwender bedacht, C berichtet von der schier unlösbaren Aufgabe eines Lektors, die Rechtschreibung in den Griff zu kriegen.

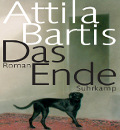 Das aufwühlendste Wort einer Sprache ist wahrscheinlich „Ende“. Wer fühlt sich dabei nicht sofort in ein Kino verschlagen, voller Gefühle und Nachdenklichkeit, wenn das Wort Ende von der Leinwand strahlt und allmählich Licht einsetzt.
Das aufwühlendste Wort einer Sprache ist wahrscheinlich „Ende“. Wer fühlt sich dabei nicht sofort in ein Kino verschlagen, voller Gefühle und Nachdenklichkeit, wenn das Wort Ende von der Leinwand strahlt und allmählich Licht einsetzt.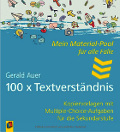 „Liebe Lehrer*, viele Schüler tun sich schwer, selbst kurze und vermeintlich leicht verständliche Sach- und Fachtexte richtig zu lesen. Das stellt die Fachlehrer immer wieder vor Probleme, da Inhalte zumeist über Sachtexte vermittelt werden. […] Dieses Buch möchte Sie bei Ihrem Anliegen unterstützen, das Textverständnis und damit die sprachlichen Kompetenzen ihrer Schüler weiterzuentwickeln.“ (6)
„Liebe Lehrer*, viele Schüler tun sich schwer, selbst kurze und vermeintlich leicht verständliche Sach- und Fachtexte richtig zu lesen. Das stellt die Fachlehrer immer wieder vor Probleme, da Inhalte zumeist über Sachtexte vermittelt werden. […] Dieses Buch möchte Sie bei Ihrem Anliegen unterstützen, das Textverständnis und damit die sprachlichen Kompetenzen ihrer Schüler weiterzuentwickeln.“ (6) Bildung lässt sich vielleicht mit jenem Kinderspiel vergleichen, das früher analog und politisch unkorrekt gespielt worden ist. „Wer fürchtet sich vorm afrikanischen Mann? - Niemand. - Wenn er aber kommt? - Laufen wir davon.“
Bildung lässt sich vielleicht mit jenem Kinderspiel vergleichen, das früher analog und politisch unkorrekt gespielt worden ist. „Wer fürchtet sich vorm afrikanischen Mann? - Niemand. - Wenn er aber kommt? - Laufen wir davon.“ „Lernen ist etwas Spontanes, Individualistisches und wird oft nur durch Anstrengung erlangt. Es ist ein zeitaufwändiger, langsamer, schritt- und stoßweißer Prozess, der einen eigenen Fluss entwickeln kann, der aber auch Leidenschaft, Geduld und Aufmerksamkeit für das Detail erfordert (sowohl von der Lehrperson, als auch von der bzw. von dem Lernenden).“ (2)
„Lernen ist etwas Spontanes, Individualistisches und wird oft nur durch Anstrengung erlangt. Es ist ein zeitaufwändiger, langsamer, schritt- und stoßweißer Prozess, der einen eigenen Fluss entwickeln kann, der aber auch Leidenschaft, Geduld und Aufmerksamkeit für das Detail erfordert (sowohl von der Lehrperson, als auch von der bzw. von dem Lernenden).“ (2)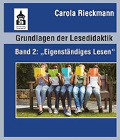 „In diesem Band soll der Blick noch einmal intensiver auf die Subjekt- und soziale Ebene der Lesekompetenz gerichtet und gefragt werden: »Was braucht man über das flüssige Dekodieren hinaus, um ein erfolgreicher Leser zu sein?«“ (1)
„In diesem Band soll der Blick noch einmal intensiver auf die Subjekt- und soziale Ebene der Lesekompetenz gerichtet und gefragt werden: »Was braucht man über das flüssige Dekodieren hinaus, um ein erfolgreicher Leser zu sein?«“ (1) Was mag da Aufregendes herauskommen, wenn in Tübingen eine Novelle gedruckt wird, worin zwanzig Jahre nach der Matura sich Lieblingslehrer und Lieblingsschüler treffen und beide als Germanisten unterwegs sind?
Was mag da Aufregendes herauskommen, wenn in Tübingen eine Novelle gedruckt wird, worin zwanzig Jahre nach der Matura sich Lieblingslehrer und Lieblingsschüler treffen und beide als Germanisten unterwegs sind? „Die zentralen Ergebnisse, zu denen Hattie gekommen ist, sind in wesentlichen Teilen eigentlich banal. Aber genau darin liegt paradoxerweise der vielleicht wichtigste Beitrag seiner Arbeit: Er hat das Selbstverständliche mit solcher Wucht und so umfassend auf den Punkt gebracht, dass es künftig kaum noch möglich sein wird, die einfachen pädagogischen Wahrheiten länger zu ignorieren.“ (6)
„Die zentralen Ergebnisse, zu denen Hattie gekommen ist, sind in wesentlichen Teilen eigentlich banal. Aber genau darin liegt paradoxerweise der vielleicht wichtigste Beitrag seiner Arbeit: Er hat das Selbstverständliche mit solcher Wucht und so umfassend auf den Punkt gebracht, dass es künftig kaum noch möglich sein wird, die einfachen pädagogischen Wahrheiten länger zu ignorieren.“ (6) „»Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter«, lautet unsere erste These. Paradox? Eher ein bewusster Kontrapunkt zum Digital-Diskurs, der im Moment recht einseitig in der Öffentlichkeit läuft.“ (7)
„»Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter«, lautet unsere erste These. Paradox? Eher ein bewusster Kontrapunkt zum Digital-Diskurs, der im Moment recht einseitig in der Öffentlichkeit läuft.“ (7) „Das vorliegende Werk will in zwei Bänden einem weit verbreiteten Mangel abhelfen. Gemeint ist die fehlende oder nur unvollkommen entfaltete Fähigkeit vieler Menschen, sich gegenüber anderen Personen oder gar in der Öffentlichkeit politisch zu artikulieren.“ (9)
„Das vorliegende Werk will in zwei Bänden einem weit verbreiteten Mangel abhelfen. Gemeint ist die fehlende oder nur unvollkommen entfaltete Fähigkeit vieler Menschen, sich gegenüber anderen Personen oder gar in der Öffentlichkeit politisch zu artikulieren.“ (9)