Herbert Rosendorfer, Neue Lieder, schlichte Weisen
 Oft erreichen überladene Dinge ihre Leichtigkeit erst durch präzise Verhöhnung. Lyrik gilt oft trotz der Seltenheit der darin vorkommenden Wörter als sehr schwere Kost, die sogar Depressionen auslösen kann.
Oft erreichen überladene Dinge ihre Leichtigkeit erst durch präzise Verhöhnung. Lyrik gilt oft trotz der Seltenheit der darin vorkommenden Wörter als sehr schwere Kost, die sogar Depressionen auslösen kann.
Herbert Rosendorfer, der alte Schelm der Literaturanwendung, greift der Lyrik dieses Mal locker unter die Arme und richtet sie an ihrer eigenen Hinfälligkeit auf. Er behauptet nämlich von seinen Texten manchmal, dass sie das gar nicht sind, als was sie sich ausgeben. So ist eine Überschrift keine Überschrift, ein Reim ist kein Reim und ein Gedicht kein Gedicht. "Ein Gedicht" Heißt das dichten? Mitnichten. (11)

 Die wahren Geschichte spielen sich meist jenseits der Google-Welt ab, nur in kurzen Schimmern tauchen dabei die Helden auf und verlöschen in sich selbst.
Die wahren Geschichte spielen sich meist jenseits der Google-Welt ab, nur in kurzen Schimmern tauchen dabei die Helden auf und verlöschen in sich selbst.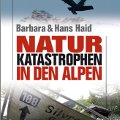 Schelmisch verkürzt könnte man sagen, die Alpen bestehen aus einem Gebirge, das in die Höhe ragt, und einem Mythos, der in die Tiefe geht. Hans und Barbara Haid kümmern sich vor allem um den Mythos mit seinem Drum und Dran.
Schelmisch verkürzt könnte man sagen, die Alpen bestehen aus einem Gebirge, das in die Höhe ragt, und einem Mythos, der in die Tiefe geht. Hans und Barbara Haid kümmern sich vor allem um den Mythos mit seinem Drum und Dran. Manche Orte strömen schon in ihrem Namen den vollen Hauch der Verbannung aus. Es klingt nach Ende, Sackgasse, schroffer Geographie. Landeck ist so ein Ort voller Verbannung, nicht umsonst liegt auf seiner Schulter eine aufgedunsene Kaserne.
Manche Orte strömen schon in ihrem Namen den vollen Hauch der Verbannung aus. Es klingt nach Ende, Sackgasse, schroffer Geographie. Landeck ist so ein Ort voller Verbannung, nicht umsonst liegt auf seiner Schulter eine aufgedunsene Kaserne. Manchmal entsteht das Ungeheure durch bloße Entlegenheit. In der Story Morbus Dei ist so ziemlich alles versteckt, entrückt und entlegen, in einem unscheinbaren Dorf in Tyrol spielen sich zu einem unauffälligen Zeitloch nach dem dreißig Jährigen Krieg vorerst unsichtbare Besonderheiten ab.
Manchmal entsteht das Ungeheure durch bloße Entlegenheit. In der Story Morbus Dei ist so ziemlich alles versteckt, entrückt und entlegen, in einem unscheinbaren Dorf in Tyrol spielen sich zu einem unauffälligen Zeitloch nach dem dreißig Jährigen Krieg vorerst unsichtbare Besonderheiten ab.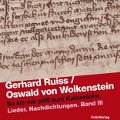
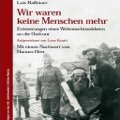 Wehrmachtserinnerungen lösen bei den Nach-Nachfahren immer ein recht unbeholfenes Gefühl aus, einerseits ist das Genre durch allzu beschönigende Literatur in der Political Correctness ziemlich geächtet, andererseits stellt sich die Frage, warum man sich nach siebzig Jahren diese Erlebnis-Literatur der makaberen Art antun soll.
Wehrmachtserinnerungen lösen bei den Nach-Nachfahren immer ein recht unbeholfenes Gefühl aus, einerseits ist das Genre durch allzu beschönigende Literatur in der Political Correctness ziemlich geächtet, andererseits stellt sich die Frage, warum man sich nach siebzig Jahren diese Erlebnis-Literatur der makaberen Art antun soll.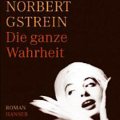 Wenn man vor und nach der Lektüre nicht weiß, wie man den Roman lesen soll, dann ist er vor allem eines: aufregend gelungen.
Wenn man vor und nach der Lektüre nicht weiß, wie man den Roman lesen soll, dann ist er vor allem eines: aufregend gelungen.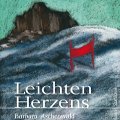
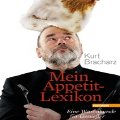 Zum Frühstück werden Prinz Charles sieben unterschiedlich weich gekochte Eier serviert, aus denen der Prinz jenes für seine Tagesverfassung passendste auswählt und verzehrt. (69)
Zum Frühstück werden Prinz Charles sieben unterschiedlich weich gekochte Eier serviert, aus denen der Prinz jenes für seine Tagesverfassung passendste auswählt und verzehrt. (69)