Reinhard Wegerth, Fast unglaublich
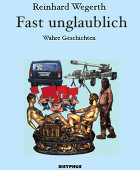 Die Literatur hat ja eine doppelte Aufgabe, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Einerseits muss sie etwas schier Undenkbares wahr machen, indem es als Literatur erzählt wird, und andererseits führt sie zum Kopfschütteln, wenn das eingepasste Weltbild des Lesers durch Abweichung von der Erzählnorm zum Vibrieren gebracht wird. – Historiker sagen nicht umsonst, dass es keine erzählte Geschichte gibt, die nicht aus der „getätigten Geschichte“ resultiert oder diese induziert.
Die Literatur hat ja eine doppelte Aufgabe, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Einerseits muss sie etwas schier Undenkbares wahr machen, indem es als Literatur erzählt wird, und andererseits führt sie zum Kopfschütteln, wenn das eingepasste Weltbild des Lesers durch Abweichung von der Erzählnorm zum Vibrieren gebracht wird. – Historiker sagen nicht umsonst, dass es keine erzählte Geschichte gibt, die nicht aus der „getätigten Geschichte“ resultiert oder diese induziert.
Reinhard Wegerth nimmt für seine wahren Geschichten einen „fast unglaublichen“ Standpunkt ein. Er lässt fünfzehn Episoden der jüngeren Geschichte Österreichs Revue passieren, indem er die beteiligten Gegenstände zu Helden macht. Seine Überlegung ist raffiniert: Wenn schon die Geschichte sich gewisser handelnder Personen bedient, um daraus Helden oder Unglücksraben zu machen, dann könnte man die beteiligten Gegenstände ebenfalls heroisch aufwerten und ihnen eine Stimme zukommen lassen, wie ja auch bei Kriminalfällen oft Gegenstände aus der Asservatenkammer geholt und während eines Prozesses befragt werden.

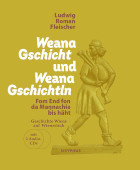 Das Buch von der Wiener Universal-Geschichte betritt man am besten, indem man wie durch einen akustischen Triumphbogen der Sprache mit zwei CDs hineinhüpft in den Text. „Weana Gschicht“ ist eine mündliche Angelegenheit, gleichsam öffentlich wie intim. Im Vorsatz sind die beiden güldenen CDs eingeklemmt. Der beigestellte Buchtext hat die Funktion, das Auge still zu halten, damit sich das Gehör konzentrieren kann. Wie eine Partitur zeigt der Text vor allem die Gliederung, die dem Jahrhundertwerk innewohnt.
Das Buch von der Wiener Universal-Geschichte betritt man am besten, indem man wie durch einen akustischen Triumphbogen der Sprache mit zwei CDs hineinhüpft in den Text. „Weana Gschicht“ ist eine mündliche Angelegenheit, gleichsam öffentlich wie intim. Im Vorsatz sind die beiden güldenen CDs eingeklemmt. Der beigestellte Buchtext hat die Funktion, das Auge still zu halten, damit sich das Gehör konzentrieren kann. Wie eine Partitur zeigt der Text vor allem die Gliederung, die dem Jahrhundertwerk innewohnt.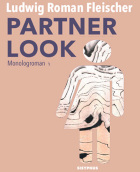 Die Weltliteratur, sagt man, ist sehr gerecht aufgebaut. Jedes Land darf einen besonderen Baustein dazu beitragen, und am Ende gibt es eine Fülle von Stoff, Erzähltechniken und überschäumenden Realismus.
Die Weltliteratur, sagt man, ist sehr gerecht aufgebaut. Jedes Land darf einen besonderen Baustein dazu beitragen, und am Ende gibt es eine Fülle von Stoff, Erzähltechniken und überschäumenden Realismus.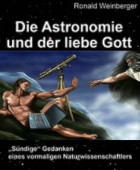 Bücher über große Themen unterliegen dem Erzählparadoxon: Je größer das Thema, desto bescheidener hat die Erzählhaltung auszufallen.
Bücher über große Themen unterliegen dem Erzählparadoxon: Je größer das Thema, desto bescheidener hat die Erzählhaltung auszufallen.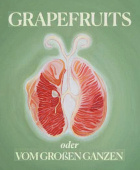 Einem Klumpen Lehm gleich wird der sogenannte Konzeptroman den Lesern auf einer Töpferscheibe angeboten, die sich beim Lesen zu drehen beginnt, sodass daraus ein persönlicher Golem geformt werden kann.
Einem Klumpen Lehm gleich wird der sogenannte Konzeptroman den Lesern auf einer Töpferscheibe angeboten, die sich beim Lesen zu drehen beginnt, sodass daraus ein persönlicher Golem geformt werden kann.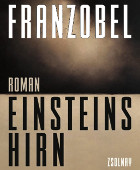 In Österreich kommen manche erst dann mit Bildung in Kontakt, wenn ihnen bei der Autopsie das Hirn entnommen und die Kopfhöhle mit der Kronenzeitung ausgestopft wird.
In Österreich kommen manche erst dann mit Bildung in Kontakt, wenn ihnen bei der Autopsie das Hirn entnommen und die Kopfhöhle mit der Kronenzeitung ausgestopft wird.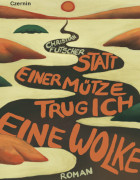 Jeder Roman lebt davon, dass er mit den Wörtern mehrdeutig umgeht. Schließlich geht es bei jedem Begriff um eine vage Gedankenbewegung. Wenn beispielsweise etwas am Kopf sein soll, ist es vorerst egal, ob es sich um eine Mütze handelt oder um eine Wolke.
Jeder Roman lebt davon, dass er mit den Wörtern mehrdeutig umgeht. Schließlich geht es bei jedem Begriff um eine vage Gedankenbewegung. Wenn beispielsweise etwas am Kopf sein soll, ist es vorerst egal, ob es sich um eine Mütze handelt oder um eine Wolke.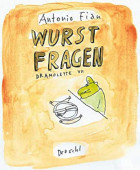 „Griassinnen!“ - Im Wiener Kaffeehaus wird schon seit Jahrhunderten gegendert, wenn eine Bestellung aufgenommen und die sitzende Hofratschaft begrüßt werden muss.
„Griassinnen!“ - Im Wiener Kaffeehaus wird schon seit Jahrhunderten gegendert, wenn eine Bestellung aufgenommen und die sitzende Hofratschaft begrüßt werden muss.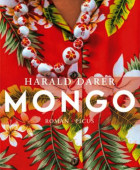 Dort hineinstierln, wo Statistiken und offizielle Curricula nicht hinkommen, das ist unter anderem die Aufgabe eines zeitgenössisch-aufgeweckten Romans.
Dort hineinstierln, wo Statistiken und offizielle Curricula nicht hinkommen, das ist unter anderem die Aufgabe eines zeitgenössisch-aufgeweckten Romans.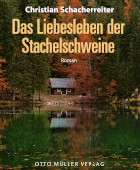 Auf der Suche nach seiner Identität wird Österreich schon mal mit einem Schloss verglichen, das Jahrhunderte überdauert hat (Tumler, Schloss in Österreich), oder mit einem von der Roten Armee in den Verfall getriebenen Marchfeld-Gütchen (Fritsch, Moos auf den Steinen). In einer gegenwartsbezogenen Deutung bietet sich an, es mit Österreich als Biomüllanlage zu versuchen.
Auf der Suche nach seiner Identität wird Österreich schon mal mit einem Schloss verglichen, das Jahrhunderte überdauert hat (Tumler, Schloss in Österreich), oder mit einem von der Roten Armee in den Verfall getriebenen Marchfeld-Gütchen (Fritsch, Moos auf den Steinen). In einer gegenwartsbezogenen Deutung bietet sich an, es mit Österreich als Biomüllanlage zu versuchen.