Robert Misik, Das große Beginnergefühl
 Eine Revolution ohne Optimismus ist schon gescheitert, ehe sie begonnen hat. So gesehen schreit die gegenwärtige Gesellschaft, wenn nicht nach Revolution, so immerhin nach Optimismus.
Eine Revolution ohne Optimismus ist schon gescheitert, ehe sie begonnen hat. So gesehen schreit die gegenwärtige Gesellschaft, wenn nicht nach Revolution, so immerhin nach Optimismus.
Robert Misik kratzt für das große „Beginnergefühl“ zweihundert Jahre Kulturgeschichte der Moderne zusammen, um zu zeigen, dass hinter allen Veränderungen immer ein Stück Optimismus gestanden hat. Das „Beginnergefühl“ ist ein Notat von Bert Brecht, verfasst mitten im Desaster des Zweiten Weltkriegs. Eines Vormittags schreibt er einfach das Gefühl vom Beginnen auf, und gibt sich dadurch einen Ruck, sich für die Zukunft bereitzumachen.

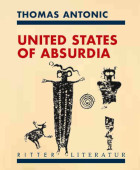 Der Volksmund formuliert bei Größenordnungen relativ klar, sofern sich Größe überhaupt vorstellen lässt. Wenn etwas abnormal groß ist, sodass es sich kaum noch erzählen lässt, spielt es in Amerika. Und alles, was darüber hinausgeht, spielt in Absurdia. Dabei ist die Grenze zwischen Amerika und Absurdia eine weiche, obwohl sie ähnlich hart gedacht ist wie jene zwischen Amerika und Mexiko.
Der Volksmund formuliert bei Größenordnungen relativ klar, sofern sich Größe überhaupt vorstellen lässt. Wenn etwas abnormal groß ist, sodass es sich kaum noch erzählen lässt, spielt es in Amerika. Und alles, was darüber hinausgeht, spielt in Absurdia. Dabei ist die Grenze zwischen Amerika und Absurdia eine weiche, obwohl sie ähnlich hart gedacht ist wie jene zwischen Amerika und Mexiko.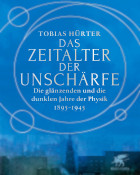 „Stellen Sie sich vor, Sie finden eines Tages heraus, dass die Welt, in der Sie leben, ganz anders funktioniert, als Sie bisher glaubten. Die Häuser, Straßen, Bäume und Wolken sind nur Kulissen, bewegt von Kräften, von denen sie nichts ahnten. Genau dies ist den Physikerinnen und Physikern vor hundert Jahren widerfahren. Sie mussten einsehen, dass hinter den Begriffen und Theorien, durch die sie die Welt sahen, eine tiefere Wirklichkeit liegt …“ (S. 9)
„Stellen Sie sich vor, Sie finden eines Tages heraus, dass die Welt, in der Sie leben, ganz anders funktioniert, als Sie bisher glaubten. Die Häuser, Straßen, Bäume und Wolken sind nur Kulissen, bewegt von Kräften, von denen sie nichts ahnten. Genau dies ist den Physikerinnen und Physikern vor hundert Jahren widerfahren. Sie mussten einsehen, dass hinter den Begriffen und Theorien, durch die sie die Welt sahen, eine tiefere Wirklichkeit liegt …“ (S. 9) Warum lassen sich die Tiere eigentlich ausrotten und abschlachten, warum tun sie nichts dagegen? – Weil sie nicht intelligent sind! Nadja Niemeyer beendet diese unintelligente Behauptung mit einem „Gegenangriff“.
Warum lassen sich die Tiere eigentlich ausrotten und abschlachten, warum tun sie nichts dagegen? – Weil sie nicht intelligent sind! Nadja Niemeyer beendet diese unintelligente Behauptung mit einem „Gegenangriff“.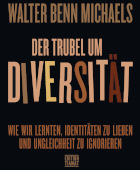 „Falsch an der Identitätspolitik ist, mit anderen Worten, dass sie nur solche Ungerechtigkeiten zur Kenntnis nimmt, die durch Diskriminierung (Rassismus, Sexismus, Homophobie) hervorgebracht werden. Die Ungleichheiten, die jedem von uns in jedem Augenblick dadurch entsteht, dass Arbeiter weniger bezahlt bekommen als den Wert dessen, was sie produzieren, werden außer Acht gelassen oder, schlimmer, als normal erachtet.“ (S. 14)
„Falsch an der Identitätspolitik ist, mit anderen Worten, dass sie nur solche Ungerechtigkeiten zur Kenntnis nimmt, die durch Diskriminierung (Rassismus, Sexismus, Homophobie) hervorgebracht werden. Die Ungleichheiten, die jedem von uns in jedem Augenblick dadurch entsteht, dass Arbeiter weniger bezahlt bekommen als den Wert dessen, was sie produzieren, werden außer Acht gelassen oder, schlimmer, als normal erachtet.“ (S. 14)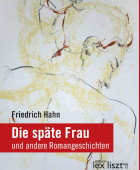 Wie an einer Schleuse treffen Autor und Leser jäh aufeinander und müssen ihre Erfahrungslevel aufeinander abstimmen, damit der Text passieren kann. Eine elementare Bedeutung kommt dabei der Außenhaut des Textes zu, die diesen vor zu hartem Aufeinandertreffen mit dem Leser und seiner Realität schützt.
Wie an einer Schleuse treffen Autor und Leser jäh aufeinander und müssen ihre Erfahrungslevel aufeinander abstimmen, damit der Text passieren kann. Eine elementare Bedeutung kommt dabei der Außenhaut des Textes zu, die diesen vor zu hartem Aufeinandertreffen mit dem Leser und seiner Realität schützt.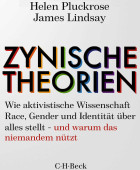 „Zynische Theorien erklärt, wie die Theorie zur treibenden Kraft im kulturellen Krieg der späten Zehnerjahre unseres Jahrtausends avancierte – und schlägt zugleich eine liberale philosophische Alternative vor, um dieser Denkströmung in Wissenschaft, Aktivismus und Alltag zu begegnen. Das Buch zeichnet nach, wie sich die einzelnen Zweige einer zynischen postmodernen Theorie in den letzten fünfzig Jahren herausbildeten, und zeigt […] den Einfluss der Theorie auf unsere heutige Gesellschaft auf.“ (S. 14)
„Zynische Theorien erklärt, wie die Theorie zur treibenden Kraft im kulturellen Krieg der späten Zehnerjahre unseres Jahrtausends avancierte – und schlägt zugleich eine liberale philosophische Alternative vor, um dieser Denkströmung in Wissenschaft, Aktivismus und Alltag zu begegnen. Das Buch zeichnet nach, wie sich die einzelnen Zweige einer zynischen postmodernen Theorie in den letzten fünfzig Jahren herausbildeten, und zeigt […] den Einfluss der Theorie auf unsere heutige Gesellschaft auf.“ (S. 14)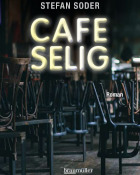 Wer rechtzeitig aus dem Studium aussteigt, kann immer noch hochglänzender Barkeeper oder Bundeskanzler werden.
Wer rechtzeitig aus dem Studium aussteigt, kann immer noch hochglänzender Barkeeper oder Bundeskanzler werden.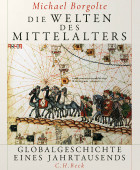 „In der folgenden untersuchenden Darstellung rückt also die Menschenwelt der drei Kontinente in den Vordergrund; sie bildete schon in der mediterranen Antike eine gedachte Einheit und kann als <trikontinentale Ökumene> oder <Eufrasien> bezeichnet werden.“ (S. 31)
„In der folgenden untersuchenden Darstellung rückt also die Menschenwelt der drei Kontinente in den Vordergrund; sie bildete schon in der mediterranen Antike eine gedachte Einheit und kann als <trikontinentale Ökumene> oder <Eufrasien> bezeichnet werden.“ (S. 31)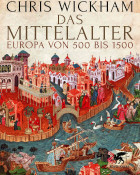 „Dieses Buch handelt vom Wandel. Die Epoche, die wir als »Mittelalter« bezeichnen, dauerte tausend Jahre, von 500 bis 1500; und Europa, das Thema dieses Buches, sah nach dieser Periode völlig anders aus als zu deren Beginn. […] Ich möchte mit diesem Buch zeigen, wie sich dieser Wandel und viele andere Wandlungsprozesse vollzogen und inwiefern sie von Bedeutung sind.“ (S. 7)
„Dieses Buch handelt vom Wandel. Die Epoche, die wir als »Mittelalter« bezeichnen, dauerte tausend Jahre, von 500 bis 1500; und Europa, das Thema dieses Buches, sah nach dieser Periode völlig anders aus als zu deren Beginn. […] Ich möchte mit diesem Buch zeigen, wie sich dieser Wandel und viele andere Wandlungsprozesse vollzogen und inwiefern sie von Bedeutung sind.“ (S. 7)