Willemijn van Dijk, Via Roma
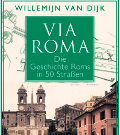 „WIE ENTSTEHT EINE Stadt? In den meisten Reiseführern liest man, Rom sei am 21. April 753 v. Chr. gegründet worden. Eine verdächtig genaue Angabe, die oft ungeprüft übernommen wird – und gedenken nicht die Römer selbst jedes Jahr am 21. April der Gründung ihrer Stadt?“ (5)
„WIE ENTSTEHT EINE Stadt? In den meisten Reiseführern liest man, Rom sei am 21. April 753 v. Chr. gegründet worden. Eine verdächtig genaue Angabe, die oft ungeprüft übernommen wird – und gedenken nicht die Römer selbst jedes Jahr am 21. April der Gründung ihrer Stadt?“ (5)
Kaum eine Stadt spricht aus so vielen Straßen und Gassen zu ihren Besuchern wie die ewige Stadt Rom. Jeder Spaziergang über die sieben Hügel und durch die zahlreichen Winkel ist gleichsam eine Reise bis in die entfernteste Vergangenheit einer Stadt, die einmal die Geschicke der antiken Welt gelenkt hat.

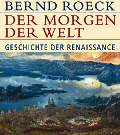 „Ohne das Gespräch mit der Antike, das die Kultur der Renaissance – Thema unserer Darstellung – zum Zentrum hat, wären diese Umbrüche undenkbar gewesen. Ohne die Möglichkeit, miteinander und gegeneinander zu reden, kritisch zu diskutieren, öffentlich zu räsonieren, wäre weder die Demokratie entstanden, noch jene Fülle technischer Neuerung und wissenschaftlicher Erkenntnisse hervorgebracht worden, die unsere Zeit prägen, im guten wie im schlechten.“ (17)
„Ohne das Gespräch mit der Antike, das die Kultur der Renaissance – Thema unserer Darstellung – zum Zentrum hat, wären diese Umbrüche undenkbar gewesen. Ohne die Möglichkeit, miteinander und gegeneinander zu reden, kritisch zu diskutieren, öffentlich zu räsonieren, wäre weder die Demokratie entstanden, noch jene Fülle technischer Neuerung und wissenschaftlicher Erkenntnisse hervorgebracht worden, die unsere Zeit prägen, im guten wie im schlechten.“ (17)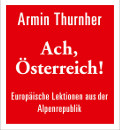 Eher gehen einem bei Österreich die Seufzer aus, als dass einem der Stoff ausginge. Eines muss man Österreich nämlich lassen, es liefert literarischen Stoff wie kaum ein anderes Land auf der Welt.
Eher gehen einem bei Österreich die Seufzer aus, als dass einem der Stoff ausginge. Eines muss man Österreich nämlich lassen, es liefert literarischen Stoff wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Erzählungen aus Mitgliedsländern der EU werden oft als Reiseführer geschmückt, damit möglichst viel Tourismus entsteht, oder als Erfolgsgeschichte der Wirtschaft dargestellt, indem zu diversen Exportleistungen passende Gesichter präsentiert werden.
Erzählungen aus Mitgliedsländern der EU werden oft als Reiseführer geschmückt, damit möglichst viel Tourismus entsteht, oder als Erfolgsgeschichte der Wirtschaft dargestellt, indem zu diversen Exportleistungen passende Gesichter präsentiert werden. Bei einem echten Amerikaner denken wir meist an einen herumballernden Viehbetreuer, der das Land auf Generationen hinaus vernichtet und sein Glück über T-Bone-Steak definiert. Dass es natürlich immer auch andere Zeitgenossen gegeben hat, die den Schutz der Natur und das Glück mit der Natur im Auge gehabt haben, wird deutlich, wenn man die wichtigsten Essays des Landes liest. Es gibt ja die schöne die Theorie, dass man ein Land nur kennenlernt, wenn man seine Essayisten liest.
Bei einem echten Amerikaner denken wir meist an einen herumballernden Viehbetreuer, der das Land auf Generationen hinaus vernichtet und sein Glück über T-Bone-Steak definiert. Dass es natürlich immer auch andere Zeitgenossen gegeben hat, die den Schutz der Natur und das Glück mit der Natur im Auge gehabt haben, wird deutlich, wenn man die wichtigsten Essays des Landes liest. Es gibt ja die schöne die Theorie, dass man ein Land nur kennenlernt, wenn man seine Essayisten liest. Bildung lässt sich vielleicht mit jenem Kinderspiel vergleichen, das früher analog und politisch unkorrekt gespielt worden ist. „Wer fürchtet sich vorm afrikanischen Mann? - Niemand. - Wenn er aber kommt? - Laufen wir davon.“
Bildung lässt sich vielleicht mit jenem Kinderspiel vergleichen, das früher analog und politisch unkorrekt gespielt worden ist. „Wer fürchtet sich vorm afrikanischen Mann? - Niemand. - Wenn er aber kommt? - Laufen wir davon.“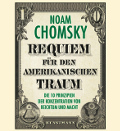 „Ein wesentlicher Bestandteil des amerikanischen Traums ist die soziale Mobilität: Auch wer arm geboren ist, kann es durch harte Arbeit zu Wohlstand bringen. Gemeint ist damit, dass jeder einen gut bezahlten Job finden, sich ein Haus und ein Auto leisten und seinen Kindern eine Ausbildung finanzieren kann … All das ist in sich zusammengebrochen.“ (11)
„Ein wesentlicher Bestandteil des amerikanischen Traums ist die soziale Mobilität: Auch wer arm geboren ist, kann es durch harte Arbeit zu Wohlstand bringen. Gemeint ist damit, dass jeder einen gut bezahlten Job finden, sich ein Haus und ein Auto leisten und seinen Kindern eine Ausbildung finanzieren kann … All das ist in sich zusammengebrochen.“ (11) Eine literarische Antwort auf die Welt der politischen Selfies und Clouds ist die Echtzeitliteratur, die im Stile eines journalistischen Selbstversuchs an sogenannten Hotspots der Weltgeschichte abläuft oder durch Inszenierung Hotspots schafft.
Eine literarische Antwort auf die Welt der politischen Selfies und Clouds ist die Echtzeitliteratur, die im Stile eines journalistischen Selbstversuchs an sogenannten Hotspots der Weltgeschichte abläuft oder durch Inszenierung Hotspots schafft.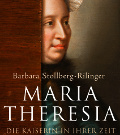 „Der Suggestionskraft dieser Heldenerzählung kann man sich schwer entziehen. Sie machte Maria Theresia im Laufe des 19. Jahrhunderts zu der Symbolgestalt österreichischer Staatlichkeit schlechthin. Es fällt schwer sich vorzustellen, dass das nicht immer so war.“ (X)
„Der Suggestionskraft dieser Heldenerzählung kann man sich schwer entziehen. Sie machte Maria Theresia im Laufe des 19. Jahrhunderts zu der Symbolgestalt österreichischer Staatlichkeit schlechthin. Es fällt schwer sich vorzustellen, dass das nicht immer so war.“ (X)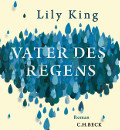 Wenn es nach den Forschungsdisziplinen Psychologie und Literatur geht, sind Vater und Tochter ausschließlich deshalb auf der Welt, damit sie Schwierigkeiten kriegen und dann einen Psychologen oder eine Bibliothek aufsuchen können.
Wenn es nach den Forschungsdisziplinen Psychologie und Literatur geht, sind Vater und Tochter ausschließlich deshalb auf der Welt, damit sie Schwierigkeiten kriegen und dann einen Psychologen oder eine Bibliothek aufsuchen können.