Judith W. Taschler, Nur nachts ist es hell
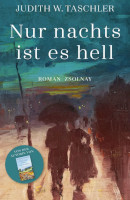 „Geschichte erzählt als Gutenachtgeschichte für Erwachsene“ – mit dieser frischen Leseempfehlung ermuntern einander die Fans von Judith Taschler, ihre neue Familiensaga zu lesen.
„Geschichte erzählt als Gutenachtgeschichte für Erwachsene“ – mit dieser frischen Leseempfehlung ermuntern einander die Fans von Judith Taschler, ihre neue Familiensaga zu lesen.
Judith Taschler legt ihr Versprechen, die Geschichte mit bemerkenswerten Schicksalen und Geschichten auszukleiden, mit Quellen gesichert offen. Im Nachklang des Romans ist ein fiktionaler Stammbaum abgedruckt, in dessen Mittelpunkt die Heldin Elisabeth Brugger steht. Sie wird aus der Ich-Perspektive etwa die Zeit vom ersten Weltkrieg bis 1972 erzählen.
Der Titel „nur nachts ist es hell“ gibt einen Hinweis auf die Erzählhaltung hinter der Heldin: Sie kramt eines Tages ein Schreibheft aus der Schublade und beginnt ihr Leben aufzuschreiben, „egal, was die Nachkommenschaft daraus einmal macht“. Diese Aufzeichnungen erhellen nächtens das Leben durch Rückschau.

 „Burke jedoch kann nur in seinem eigenen Jahrhundert verstanden werden. Politik war für ihn keine Sache von Ideologien, sondern die an den Tugenden der Klugheit und Mäßigung orientierte Suche nach Lösungen für konkrete Probleme. Als Whig, der nur angesichts der Französischen Revolution die Notwendigkeit verspürte, sich als »Old Whig« zu bezeichnen, war er ein Kind des Zeitalters der Aufklärung.“ (S. 10)
„Burke jedoch kann nur in seinem eigenen Jahrhundert verstanden werden. Politik war für ihn keine Sache von Ideologien, sondern die an den Tugenden der Klugheit und Mäßigung orientierte Suche nach Lösungen für konkrete Probleme. Als Whig, der nur angesichts der Französischen Revolution die Notwendigkeit verspürte, sich als »Old Whig« zu bezeichnen, war er ein Kind des Zeitalters der Aufklärung.“ (S. 10)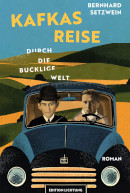 Aufregende Vorstellung: Franz Kafka hat 1924 seinen Tod nur vorgetäuscht, ist untergetaucht, hat die Nazis überlebt und erscheint nach 1945 in Meran, wo er im Apollo-Kino Karten abreißt. Als Qualifikation für diese Tätigkeit dient ihm die eigene Erzählung vom Türhüter, welcher bekanntlich streng darauf achtet, dass niemand Falscher das Gebäude betritt.
Aufregende Vorstellung: Franz Kafka hat 1924 seinen Tod nur vorgetäuscht, ist untergetaucht, hat die Nazis überlebt und erscheint nach 1945 in Meran, wo er im Apollo-Kino Karten abreißt. Als Qualifikation für diese Tätigkeit dient ihm die eigene Erzählung vom Türhüter, welcher bekanntlich streng darauf achtet, dass niemand Falscher das Gebäude betritt.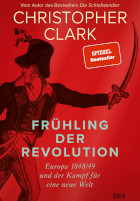 „In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus.“ (S. 9)
„In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus.“ (S. 9)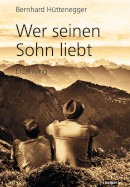 Das schriftstellerische Werk gilt Meistern erst dann als abgerundet, wenn darin jene Kindheit erzählt ist, die zum Schreiben geführt hat.
Das schriftstellerische Werk gilt Meistern erst dann als abgerundet, wenn darin jene Kindheit erzählt ist, die zum Schreiben geführt hat.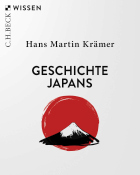 „Das vorliegenden Buch ist […] keine antiquarische Historie, sondern geht genealogisch von der japanischen Gesellschaft und Kultur im globalen Kontext aus, wie sie sich uns heute präsentiert, und sucht deren Entstehung historisch zu erhellen. Dabei gebührt der vormodernen Geschichte eine ausführliche Behandlung, allein schon, weil sie Referenzpunkt zahlreicher Identitätsaussagen in der Gegenwart ist.“ (S. 8)
„Das vorliegenden Buch ist […] keine antiquarische Historie, sondern geht genealogisch von der japanischen Gesellschaft und Kultur im globalen Kontext aus, wie sie sich uns heute präsentiert, und sucht deren Entstehung historisch zu erhellen. Dabei gebührt der vormodernen Geschichte eine ausführliche Behandlung, allein schon, weil sie Referenzpunkt zahlreicher Identitätsaussagen in der Gegenwart ist.“ (S. 8)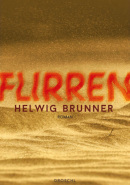 Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.
Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen. In der Literatur werden Geschichten manchmal so heiß, dass man sie nur erzählen kann, wenn man gleichzeitig die Kühlelemente beschreibt, die zu ihrem Schutz installiert worden sind. „Knisternde Schädel“ sind zwanzig kleine Geschichten, die unter Überdruck in der Psychiatrie entstanden sind. Das Knistern im Kopfinnern diverser Helden deutet darauf hin, dass darin andere atmosphärische Drücke herrschen als in der sogenannten normalen Welt.
In der Literatur werden Geschichten manchmal so heiß, dass man sie nur erzählen kann, wenn man gleichzeitig die Kühlelemente beschreibt, die zu ihrem Schutz installiert worden sind. „Knisternde Schädel“ sind zwanzig kleine Geschichten, die unter Überdruck in der Psychiatrie entstanden sind. Das Knistern im Kopfinnern diverser Helden deutet darauf hin, dass darin andere atmosphärische Drücke herrschen als in der sogenannten normalen Welt.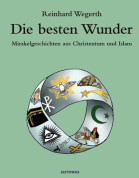 Suche den Kern der Hülle! – In der Literatur gibt es ständig neue Rätsel zu lösen, deren Lösungen später wieder zum Aufbau neuer Rätsel genutzt werden können. Reinhard Wegerth nimmt die „besten Wunder“ aus den Gründungsmythen von Islam und Christentum unter seine literarischen Fittiche, indem er sie ohne Vorurteile behutsam aus dem religiösen Kontext schält und als Präparate der Fiktion unter das Lektüre-Mikroskop legt.
Suche den Kern der Hülle! – In der Literatur gibt es ständig neue Rätsel zu lösen, deren Lösungen später wieder zum Aufbau neuer Rätsel genutzt werden können. Reinhard Wegerth nimmt die „besten Wunder“ aus den Gründungsmythen von Islam und Christentum unter seine literarischen Fittiche, indem er sie ohne Vorurteile behutsam aus dem religiösen Kontext schält und als Präparate der Fiktion unter das Lektüre-Mikroskop legt. Mutterliebe, Mutterschutz, Mutterwitz – mit allem ist in der Literatur zu rechnen. Aber Mutternichts? Ein irritierender Titel wie alles, bei dem das Nichts die Hauptrolle spielt. Christine Vescoli versucht sich an einem erzählerischen Kunststück, sie lässt eine Ich-Erzählerin über die Mutter reflektieren. Und obwohl es in der Erinnerungsliteratur hunderte von Schablonen für Mutter-Gedenken gibt, steht sie vor dem Nichts. „Mutter zieht sich ins Nichts zurück.“ (7)
Mutterliebe, Mutterschutz, Mutterwitz – mit allem ist in der Literatur zu rechnen. Aber Mutternichts? Ein irritierender Titel wie alles, bei dem das Nichts die Hauptrolle spielt. Christine Vescoli versucht sich an einem erzählerischen Kunststück, sie lässt eine Ich-Erzählerin über die Mutter reflektieren. Und obwohl es in der Erinnerungsliteratur hunderte von Schablonen für Mutter-Gedenken gibt, steht sie vor dem Nichts. „Mutter zieht sich ins Nichts zurück.“ (7)