Petra Ganglbauer, Mit allen Sinnen
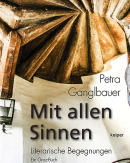 In der Literatur sind alle Zeiten gleichzeitig vorhanden, wenn wir uns auf den Weg machen, eine Erinnerung, eine Stadt oder eine Freundschaft abzurufen.
In der Literatur sind alle Zeiten gleichzeitig vorhanden, wenn wir uns auf den Weg machen, eine Erinnerung, eine Stadt oder eine Freundschaft abzurufen.
Petra Ganglbauer hat vor gut dreißig Jahren Graz verlassen und ist nach Wien gezogen, aber deshalb hat die Stadt noch lange nicht ihre Bindungen und Emotionen gekappt. Im Gegenteil, wenn jemand nach so langer Zeit einen intensiven Erkundungsaufenthalt angeht, springen plötzlich alle Sinne an. Deshalb ist dieses literarische Begegnungsbuch auch ein Rundum-Erlebnis, worin sich Kindheit, Spaziergänge, Plätze und Freunde auf dem Pflaster der Zeit wiedereinfinden.

 An manchen Tagen steigt die Lyrik aus jeglichem Zeitgeist aus und erzählt etwas vom archaischen Verhältnis zwischen Mensch und Natur, Arbeit und Religion.
An manchen Tagen steigt die Lyrik aus jeglichem Zeitgeist aus und erzählt etwas vom archaischen Verhältnis zwischen Mensch und Natur, Arbeit und Religion.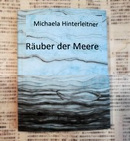 In den Sehnsuchtsvorstellungen vom Meer liegt im Unterbewusstsein meist noch etwas brach: Raubfische, Raubtiere, Seeräuber, Raubbau an der Natur.
In den Sehnsuchtsvorstellungen vom Meer liegt im Unterbewusstsein meist noch etwas brach: Raubfische, Raubtiere, Seeräuber, Raubbau an der Natur.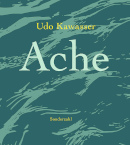 Was als Wort kurz wie ein Seufzer klingt, ist als Vorbild einer Studie für die Sinnesorgane und hat die Länge von 67 Kilometern.
Was als Wort kurz wie ein Seufzer klingt, ist als Vorbild einer Studie für die Sinnesorgane und hat die Länge von 67 Kilometern.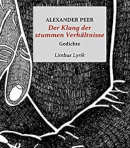 In der Lyrik sind die Sinnesorgane oft eigenartig verkabelt, das Gehör ist an die Haut angeschlossen, der Geruchssinn tastet mit den Sohlen den Boden ab, die Netzhaut sitzt am Gaumen und scannt diverse Geschmäcker. Und selbstverständlich funktioniert das alles auch remote, der Leser liegt im Bett und wischt sich den letzten Herbst aus dem Display.
In der Lyrik sind die Sinnesorgane oft eigenartig verkabelt, das Gehör ist an die Haut angeschlossen, der Geruchssinn tastet mit den Sohlen den Boden ab, die Netzhaut sitzt am Gaumen und scannt diverse Geschmäcker. Und selbstverständlich funktioniert das alles auch remote, der Leser liegt im Bett und wischt sich den letzten Herbst aus dem Display.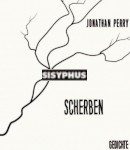 Scherben sind ein faszinierendes Gebilde voller Widerstand und Querköpfigkeit. Meist sind sie Elemente aus einem größeren Ganzen, das zu Bruch gegangen ist, oft liegen sie in trockenem Gelände herum und lösen bei gutem Sonnenlicht heftige Waldbrände aus. Und kaum geht man barfuß, tritt man sich trittsicher etwas ein, was sich spontan in einem Schmerzseufzer entlädt.
Scherben sind ein faszinierendes Gebilde voller Widerstand und Querköpfigkeit. Meist sind sie Elemente aus einem größeren Ganzen, das zu Bruch gegangen ist, oft liegen sie in trockenem Gelände herum und lösen bei gutem Sonnenlicht heftige Waldbrände aus. Und kaum geht man barfuß, tritt man sich trittsicher etwas ein, was sich spontan in einem Schmerzseufzer entlädt.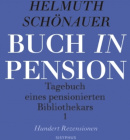 „Jeder, der von Helmuth Schönauers fünftausend Buchbesprechungen erfährt, fragt sich, wie schreibt man fünftausend Buchbesprechungen, und wieso tut man das.“ (S. 5)
„Jeder, der von Helmuth Schönauers fünftausend Buchbesprechungen erfährt, fragt sich, wie schreibt man fünftausend Buchbesprechungen, und wieso tut man das.“ (S. 5) Lyrik ist nur im Hardcore ein poetisches Gebilde, das aus seltsamen Wortkonstellationen besteht. In der dynamischen Gedichte-Welt der Gegenwart sitzt die Poesie als Humor, Wissenschaft, Dramaturgie oder Drehbuch zwischen den Zeilen. Manche Gedichte dieser Bauart sind nur durch Zufall ein Gedicht geworden, genauso gut könnten sie ein Spielfilm oder ein Theaterstück sein.
Lyrik ist nur im Hardcore ein poetisches Gebilde, das aus seltsamen Wortkonstellationen besteht. In der dynamischen Gedichte-Welt der Gegenwart sitzt die Poesie als Humor, Wissenschaft, Dramaturgie oder Drehbuch zwischen den Zeilen. Manche Gedichte dieser Bauart sind nur durch Zufall ein Gedicht geworden, genauso gut könnten sie ein Spielfilm oder ein Theaterstück sein. Im Sprachgebrauch sind anschwellende Wortwellen vorgesehen, die auf etwas Unheimliches, Gigantisches oder Katastrophales hinweisen. „Zur Lage“ wird durchaus als pathetische Einstimmung verwendet, wenn es um die Lage der Nation, die Lage der Finanzen oder die Lage an einer Grenze geht.
Im Sprachgebrauch sind anschwellende Wortwellen vorgesehen, die auf etwas Unheimliches, Gigantisches oder Katastrophales hinweisen. „Zur Lage“ wird durchaus als pathetische Einstimmung verwendet, wenn es um die Lage der Nation, die Lage der Finanzen oder die Lage an einer Grenze geht. Da muss jemand schon eine seltsame Reise getätigt haben, wenn die Leute zu Hause vielleicht warten und sich wünschen: Erzähl mir vom Mistral. Üblicherweise werden die Hinterbliebenen mit Selfies überpixelt und die Reise ist bald einmal vom Display gewischt.
Da muss jemand schon eine seltsame Reise getätigt haben, wenn die Leute zu Hause vielleicht warten und sich wünschen: Erzähl mir vom Mistral. Üblicherweise werden die Hinterbliebenen mit Selfies überpixelt und die Reise ist bald einmal vom Display gewischt.