Drago Glamuzina, Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
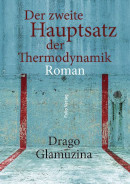 Unterliegt die berüchtigte heiße Luft beim Diskutieren dem sogenannten thermodynamischen Gesetz? Dieser zweite Hauptsatz sagt im Volksmund ja nicht viel mehr, als dass die heiße Luft beim Reden immer gleich warm bleibt.
Unterliegt die berüchtigte heiße Luft beim Diskutieren dem sogenannten thermodynamischen Gesetz? Dieser zweite Hauptsatz sagt im Volksmund ja nicht viel mehr, als dass die heiße Luft beim Reden immer gleich warm bleibt.
Drago Glamuzina nimmt für seinen Roman über eine kroatische Intellektuellenszene einen sehr aufgeblasenen Titel, weil es zum Wesen dieser Spezies gehört, aufgeblasen zu reden. Gleichzeitig dient das Zitieren des Wärmegesetzes als sogenannte Hirnschranke gegen allzu ungebildete Lektüre. Wer sich also auf diesen Roman einlässt, kann sich als halbwegs intellektuell fühlen, zumal sich der Titel mit einer KI recht schnell dechiffrieren lässt.

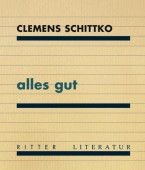 Literatur spielt ähnlich wie Mathematik auf verschiedenen Ebenen, die über Ableitungen und Hyperlinks miteinander in Verbindung stehen. In der einfachsten Literaturform gibt etwas vor, ein Sachverhalt zu sein, der mit Worten in literarische Wirklichkeit versetzt werden kann.
Literatur spielt ähnlich wie Mathematik auf verschiedenen Ebenen, die über Ableitungen und Hyperlinks miteinander in Verbindung stehen. In der einfachsten Literaturform gibt etwas vor, ein Sachverhalt zu sein, der mit Worten in literarische Wirklichkeit versetzt werden kann. Umgangssprachlich gilt schon die Bezeichnung „Das Mensch“ als ziemlich abwertend, die Steigerung in „Das Rotzmensch“ kann als Inbegriff für Verachtung betrachtet werden.
Umgangssprachlich gilt schon die Bezeichnung „Das Mensch“ als ziemlich abwertend, die Steigerung in „Das Rotzmensch“ kann als Inbegriff für Verachtung betrachtet werden. Nichts ist so groß wie ein Wort, das aus einem weiten Bild heraus verdichtet worden ist. Edgar Hättich nimmt aus den Nächten eines langen Lebens jenen Augenblick ins Auge, wenn für einen kurzen Augenblick der Mond andeutet, dass er seine Überfahrt durch die Nacht beginnen wird. „Mondsichelboot“: Für das lyrische Ich wird es Zeit, die Gedichte an jenen Fensterflügeln anzulehnen, die die Kühle regeln während des Schlafs.
Nichts ist so groß wie ein Wort, das aus einem weiten Bild heraus verdichtet worden ist. Edgar Hättich nimmt aus den Nächten eines langen Lebens jenen Augenblick ins Auge, wenn für einen kurzen Augenblick der Mond andeutet, dass er seine Überfahrt durch die Nacht beginnen wird. „Mondsichelboot“: Für das lyrische Ich wird es Zeit, die Gedichte an jenen Fensterflügeln anzulehnen, die die Kühle regeln während des Schlafs. Während politische Entscheidungsfragen überall auf der Welt mit ja oder nein beantwortet werden, sagt man in Österreich auf eine Entscheidungsfrage oft: „später“. Bereits Kindern wird dieses Wort beigebracht, wenn sie um etwas betteln. Ein Leben lang beherrscht dieses Wort die Entscheidungsfindung, und selbst wenn in hohem Alter jemand um Sterbeassistenz bittet, wird er auf später verwiesen.
Während politische Entscheidungsfragen überall auf der Welt mit ja oder nein beantwortet werden, sagt man in Österreich auf eine Entscheidungsfrage oft: „später“. Bereits Kindern wird dieses Wort beigebracht, wenn sie um etwas betteln. Ein Leben lang beherrscht dieses Wort die Entscheidungsfindung, und selbst wenn in hohem Alter jemand um Sterbeassistenz bittet, wird er auf später verwiesen.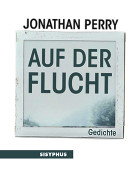 „Lebt mit Frau und Kind in St. Pölten.“ – Diese zu einer Inschrift verdichtete Bio-Zeile beschreibt auch gleich jenen Kosmos, in dem der Gedichtband „Auf der Flucht“ spielt.
„Lebt mit Frau und Kind in St. Pölten.“ – Diese zu einer Inschrift verdichtete Bio-Zeile beschreibt auch gleich jenen Kosmos, in dem der Gedichtband „Auf der Flucht“ spielt.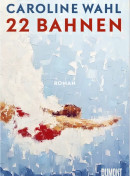 Manchmal wird der Literatur ein Programm übergestülpt, das ihre Kundschaft zuerst abarbeiten muss, ehe sie sich dem eigentlichen Text zuwenden darf. So sind es oft Literaturpreise, die vorerst in Marketing-Manier den Text zuschütten, ehe er sich verspätet der Leserschaft erschließt.
Manchmal wird der Literatur ein Programm übergestülpt, das ihre Kundschaft zuerst abarbeiten muss, ehe sie sich dem eigentlichen Text zuwenden darf. So sind es oft Literaturpreise, die vorerst in Marketing-Manier den Text zuschütten, ehe er sich verspätet der Leserschaft erschließt.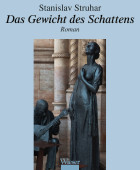 Je größer die Heimat, umso verlorener bewegt sich darin der Heimatlose. Stanislav Struhar versetzt seine Helden in den Modus von Schatten, alles ist seltsam leicht und dennoch bunt, die Konturen der Handlungen gleichen Erinnerungen und fransen zwischendurch aus, die Stabilität der Körper zuckt fahl über jene Oberflächen, auf denen sie agieren. Bald kommt einem die „Höhlenparabel“ von Platon in den Sinn, worin auf der Suche nach Wahrheit alles zu Schatten wird.
Je größer die Heimat, umso verlorener bewegt sich darin der Heimatlose. Stanislav Struhar versetzt seine Helden in den Modus von Schatten, alles ist seltsam leicht und dennoch bunt, die Konturen der Handlungen gleichen Erinnerungen und fransen zwischendurch aus, die Stabilität der Körper zuckt fahl über jene Oberflächen, auf denen sie agieren. Bald kommt einem die „Höhlenparabel“ von Platon in den Sinn, worin auf der Suche nach Wahrheit alles zu Schatten wird.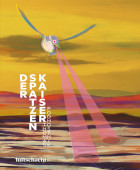 Für gewöhnlich läuft das Leben so dahin, ehe dann vielleicht ein Spatz vom Himmel fällt, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben.
Für gewöhnlich läuft das Leben so dahin, ehe dann vielleicht ein Spatz vom Himmel fällt, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben. Werkzeuge lassen sich in zwei Richtungen hin einsetzen, einmal, um einen bestimmten Sachverhalt zu erkunden, zu korrigieren oder zu optimieren, und im umgekehrten Sinn, indem man schaut, wofür sich dieses Werkzeug zusätzlich verwenden ließe.
Werkzeuge lassen sich in zwei Richtungen hin einsetzen, einmal, um einen bestimmten Sachverhalt zu erkunden, zu korrigieren oder zu optimieren, und im umgekehrten Sinn, indem man schaut, wofür sich dieses Werkzeug zusätzlich verwenden ließe.