Dieter Sperl, An so viele wie mich
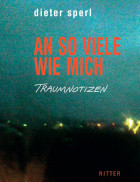 Stell dir eine Zimmer-große Kiste vor, darin sind lauter Scharniere eingelagert. Wenn du sie einzeln verwendest, kannst du alles damit beweglich und mehrdeutig gestalten. Dieter Sperl verschenkt eine ganze Charge solcher Scharniere, er nennt sie Traumnotizen und es geht um diese bewegliche Naht zwischen Traum- und Tages-Wirklichkeit. „An so viele wie mich“ eignet sich bestens als Titel, denn diese Fügung lässt sich vorne und hinten ausbauen zu einem multiplen Ereignis.
Stell dir eine Zimmer-große Kiste vor, darin sind lauter Scharniere eingelagert. Wenn du sie einzeln verwendest, kannst du alles damit beweglich und mehrdeutig gestalten. Dieter Sperl verschenkt eine ganze Charge solcher Scharniere, er nennt sie Traumnotizen und es geht um diese bewegliche Naht zwischen Traum- und Tages-Wirklichkeit. „An so viele wie mich“ eignet sich bestens als Titel, denn diese Fügung lässt sich vorne und hinten ausbauen zu einem multiplen Ereignis.
Wahrscheinlich sollte man den Begriff „Traumnotizen“ verschiedenen Bedeutungsfeldern zuweisen, einmal sind es wohl Notizen, die jemand im Umfeld eines Traums gestaltet hat, andererseits kann es sich auch um Notizen handeln, die Lesende zum Träumen bringen, ja sogar der Autor selbst kann die Texte für höchst gelungen halten, im Sinne von Traum-Urlaub, Traum-Angebot. Und schließlich weist der Traum-Begriff auf etwas Kollektives hin, das von der Gesellschaft teils träumerisch, teils traumatisiert bewältigt wird – die Pandemie.

 Der Dichter ist in die Berge abgehauen und gilt als verschollen, das Publikum ist ungeduldig, es hat zwei Bücher über schwere Helden-Entgleisung gelesen und will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Die Heldin „Blumberg 3“ sitzt in der Psychiatrie und und bietet in hellen Momenten an, ihr kriminelles Leben fertig zu erzählen. – Eine ideale Ausgangsposition für einen Roman, als ein Verleger den erlösenden Schreibauftrag vergibt, um endlich alle von der Last der nicht-erzählten Geschichte zu erlösen.
Der Dichter ist in die Berge abgehauen und gilt als verschollen, das Publikum ist ungeduldig, es hat zwei Bücher über schwere Helden-Entgleisung gelesen und will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Die Heldin „Blumberg 3“ sitzt in der Psychiatrie und und bietet in hellen Momenten an, ihr kriminelles Leben fertig zu erzählen. – Eine ideale Ausgangsposition für einen Roman, als ein Verleger den erlösenden Schreibauftrag vergibt, um endlich alle von der Last der nicht-erzählten Geschichte zu erlösen. „Man hat mir nichts gegeben, was mir helfen würde zu existieren. Weder Glauben noch Hoffnung, um zu bereuen, zu bitten und erlöst zu werden.“ (45) Brane Mozetič gilt als der am meisten übersetzte slowenische Autor der Gegenwart, das hat mit seinen Themen zu tun, seiner Beharrlichkeit und der Ortsungebundenheit seiner Lyrik.
„Man hat mir nichts gegeben, was mir helfen würde zu existieren. Weder Glauben noch Hoffnung, um zu bereuen, zu bitten und erlöst zu werden.“ (45) Brane Mozetič gilt als der am meisten übersetzte slowenische Autor der Gegenwart, das hat mit seinen Themen zu tun, seiner Beharrlichkeit und der Ortsungebundenheit seiner Lyrik.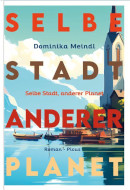 Wenn das gesellschaftliche Leben eine Inszenierung ist, muss dann nicht auch das Individuum sich selbst inszenieren? Macht es einen Unterschied, ob eine Fassade historisch gewachsen oder von einer KI gestaltet vor der Selfie-Kamera auftaucht? Ist ein absolutes System wie die Volksrepublik China vielleicht ähnlich organisiert wie die für den Tourismus ausgereizte Region rund um Hallstatt?
Wenn das gesellschaftliche Leben eine Inszenierung ist, muss dann nicht auch das Individuum sich selbst inszenieren? Macht es einen Unterschied, ob eine Fassade historisch gewachsen oder von einer KI gestaltet vor der Selfie-Kamera auftaucht? Ist ein absolutes System wie die Volksrepublik China vielleicht ähnlich organisiert wie die für den Tourismus ausgereizte Region rund um Hallstatt? Wenn jemand eine wortlose Kindheit erfahren hat, wie soll er später davon erzählen? Robert Kleindienst nimmt sich das Schicksal seines Vaters zu Herzen, der einst ziemlich wortlos im Tiroler Oberland bei einer Pflegefamilie aufgenommen und bald darauf in die berüchtigte Bubenburg im Zillertal gesteckt worden ist. Später in Salzburg ist er dann ein geschätzter Musiker geworden, der den Ton der Wortlosigkeit beim Publikum getroffen hat. Offensichtlich lässt sich die Sprachlosigkeit der Nachkriegszeit später mit Musik überwinden.
Wenn jemand eine wortlose Kindheit erfahren hat, wie soll er später davon erzählen? Robert Kleindienst nimmt sich das Schicksal seines Vaters zu Herzen, der einst ziemlich wortlos im Tiroler Oberland bei einer Pflegefamilie aufgenommen und bald darauf in die berüchtigte Bubenburg im Zillertal gesteckt worden ist. Später in Salzburg ist er dann ein geschätzter Musiker geworden, der den Ton der Wortlosigkeit beim Publikum getroffen hat. Offensichtlich lässt sich die Sprachlosigkeit der Nachkriegszeit später mit Musik überwinden.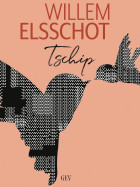 Selbst ein Klassiker muss ununterbrochen gepflegt und gegen das Vergessen gebürstet werden. Aufwändig wird diese Pflege, wenn es dazu einer Übersetzung bedarf, die den Ansprüchen von Zeitgeist und Sprachentwicklung entspricht.
Selbst ein Klassiker muss ununterbrochen gepflegt und gegen das Vergessen gebürstet werden. Aufwändig wird diese Pflege, wenn es dazu einer Übersetzung bedarf, die den Ansprüchen von Zeitgeist und Sprachentwicklung entspricht.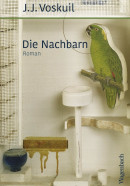 Trabanten veredeln das Muttergestirn, indem sie unermüdlich darum herumkreisen. In der Literatur veredeln posthume Editionen oft das Hauptwerk, indem sie sich ungeniert als pfiffige Text-Trabanten ausgeben.
Trabanten veredeln das Muttergestirn, indem sie unermüdlich darum herumkreisen. In der Literatur veredeln posthume Editionen oft das Hauptwerk, indem sie sich ungeniert als pfiffige Text-Trabanten ausgeben.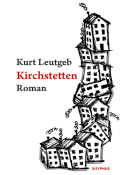 Kurt Leutgeb geht in seinem Roman „Kirchstetten“ davon aus, dass nichts eindeutig ist. Das beginnt schon mit dem Ort Kirchstetten, der dreimal rund um Wien vorkommt und ständig verwechselt wird. Damit diese Orte wenigstens historisch unverwechselbar werden, verpasst ihnen der Autor jeweils eine einmalige Geschichte.
Kurt Leutgeb geht in seinem Roman „Kirchstetten“ davon aus, dass nichts eindeutig ist. Das beginnt schon mit dem Ort Kirchstetten, der dreimal rund um Wien vorkommt und ständig verwechselt wird. Damit diese Orte wenigstens historisch unverwechselbar werden, verpasst ihnen der Autor jeweils eine einmalige Geschichte. Die sensiblen Kunstformen Gedicht und Kurzgeschichten lassen sich in ihrer Halbwertszeit des Verfalls hinauszögern, wenn das Gedicht prosaische Züge trägt und die Kurzgeschichte psychologisch-poetische Tiefen aufsucht.
Die sensiblen Kunstformen Gedicht und Kurzgeschichten lassen sich in ihrer Halbwertszeit des Verfalls hinauszögern, wenn das Gedicht prosaische Züge trägt und die Kurzgeschichte psychologisch-poetische Tiefen aufsucht.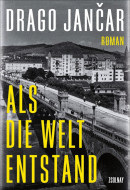 Beim großen Blick auf die Welt vergessen wir meist, ihre Entstehung zu beachten. Die Welt entsteht mit jedem Menschen neu und wird ihm spätestens mit der Pubertät über den Kopf gestülpt.
Beim großen Blick auf die Welt vergessen wir meist, ihre Entstehung zu beachten. Die Welt entsteht mit jedem Menschen neu und wird ihm spätestens mit der Pubertät über den Kopf gestülpt.