Andrej Kurkow, Die Kugel auf dem Weg zum Helden
 In diversen Heldenbiographien inklusive jener von Andreas Hofer wird immer zu wenig die Kugel gewürdigt, die aus einem normalen Menschen einen Helden macht.
In diversen Heldenbiographien inklusive jener von Andreas Hofer wird immer zu wenig die Kugel gewürdigt, die aus einem normalen Menschen einen Helden macht.
Andrej Kurkow lässt es sich in seiner Trilogie „Geographie eines einzelnen Schusses“ nicht nehmen, etwas logisch Groteskes wie die Sowjetunion durch grotesk-logisch Helden darzustellen. Nach einem Volkskommissar, der ein Leben lang das Volk inspizieren muss, und einem Papagei, der politische Sprüche in krächzende Epen zu verwandeln hat, macht sich jetzt eine Kugel auf den Weg, einen Gerechten zu finden. Der Kugel beigesellt ist ein Engel, der den Helden immateriell retten kann, wenn er von der Kugel zerfetzt sein sollte.

 Was passiert eigentlich, wenn jemand, der das Verschwinden von Personen und Dingen bemerkt, selbst verschwindet?
Was passiert eigentlich, wenn jemand, der das Verschwinden von Personen und Dingen bemerkt, selbst verschwindet? Wie muss man kleine Begebenheiten, entlegene Landstriche, versteckte Stimmungen oder verlorengegangene Lebensentwürfe aufrüsten, dass man sie als Andeutung gerade noch erzählen kann?
Wie muss man kleine Begebenheiten, entlegene Landstriche, versteckte Stimmungen oder verlorengegangene Lebensentwürfe aufrüsten, dass man sie als Andeutung gerade noch erzählen kann?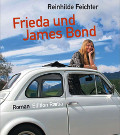 Bildung entsteht letztlich dadurch, dass man sich als Individuum eine persönliche App in seine Psyche herunterlädt, die einem immer erklärt, was man zu tun hat.
Bildung entsteht letztlich dadurch, dass man sich als Individuum eine persönliche App in seine Psyche herunterlädt, die einem immer erklärt, was man zu tun hat. 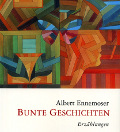 Immer wieder machen sich in der Malerei Sequenzen selbständig und werden zur Literatur. Aus Bildbeschreibungen, Paint-Journalen oder Katalogvorgaben nehmen zwischendurch Texte Reißaus und flüchten in einen eigenen Erzählband, der dann vielleicht „Bunte Geschichten“ heißt.
Immer wieder machen sich in der Malerei Sequenzen selbständig und werden zur Literatur. Aus Bildbeschreibungen, Paint-Journalen oder Katalogvorgaben nehmen zwischendurch Texte Reißaus und flüchten in einen eigenen Erzählband, der dann vielleicht „Bunte Geschichten“ heißt.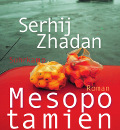 Ein gelungenes Cover vermag sinnlich auf das Kernthema eines Buches hinzuweisen. Wenn selbst der Titel „Mesopo / tamien“ in zwei Teile zerlegt ist, vermag man sich schon auszumalen, welche Zerrissenheit einen in diesem Zweistromland erwarten wird.
Ein gelungenes Cover vermag sinnlich auf das Kernthema eines Buches hinzuweisen. Wenn selbst der Titel „Mesopo / tamien“ in zwei Teile zerlegt ist, vermag man sich schon auszumalen, welche Zerrissenheit einen in diesem Zweistromland erwarten wird. Gedichtbände haben immer auch ein geheimes Drehbuch unter der Gedicht-Haut mitlaufen, damit sich die poetischen Sporen auch im Wind der Gegenwart verbreiten können.
Gedichtbände haben immer auch ein geheimes Drehbuch unter der Gedicht-Haut mitlaufen, damit sich die poetischen Sporen auch im Wind der Gegenwart verbreiten können. Zukunftsprognosen werden meist von jener Stimmung getragen, die gerade in der Gegenwart als virulent empfunden werden. Prognostische Romane sagen also immer etwas über die Gegenwart aus.
Zukunftsprognosen werden meist von jener Stimmung getragen, die gerade in der Gegenwart als virulent empfunden werden. Prognostische Romane sagen also immer etwas über die Gegenwart aus.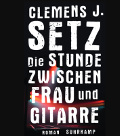 Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.
Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.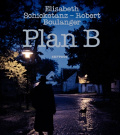 Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen.
Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen.