Rüdiger Görner, Levins Abschied
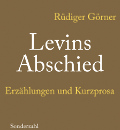 Die Aufzeichnungen sind oft das Schönste von einem Ereignis oder Lebensabschnitt, im Idealfall gelingt es, heftige Erlebnisse in das Reagenzglas einer Impression zu drängen.
Die Aufzeichnungen sind oft das Schönste von einem Ereignis oder Lebensabschnitt, im Idealfall gelingt es, heftige Erlebnisse in das Reagenzglas einer Impression zu drängen.
Rüdiger Görner spielt die gut dreißig Geschichten in beeindruckendem Rhythmus ab, auf kurze emotionale Blitzeinschläge folgen durchaus lange Erlebnis-Elegien, worin sich die Vorgänge noch während des Erzählens kristallklar absetzen können.

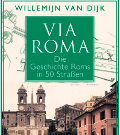 „WIE ENTSTEHT EINE Stadt? In den meisten Reiseführern liest man, Rom sei am 21. April 753 v. Chr. gegründet worden. Eine verdächtig genaue Angabe, die oft ungeprüft übernommen wird – und gedenken nicht die Römer selbst jedes Jahr am 21. April der Gründung ihrer Stadt?“ (5)
„WIE ENTSTEHT EINE Stadt? In den meisten Reiseführern liest man, Rom sei am 21. April 753 v. Chr. gegründet worden. Eine verdächtig genaue Angabe, die oft ungeprüft übernommen wird – und gedenken nicht die Römer selbst jedes Jahr am 21. April der Gründung ihrer Stadt?“ (5) Große Erzählungen stellen immer auch scheinbar kleinliche Fragen, etwa, wie spielt man als Trommler die Nationalhymne? oder hat das Alter des Spaten einen Einfluss auf den Schlag, der dem Nachbarn über den Kopf gezogen wird?
Große Erzählungen stellen immer auch scheinbar kleinliche Fragen, etwa, wie spielt man als Trommler die Nationalhymne? oder hat das Alter des Spaten einen Einfluss auf den Schlag, der dem Nachbarn über den Kopf gezogen wird?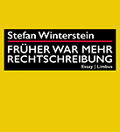 Menschen, die sich um Rechtschreibung kümmern, werden zwischendurch scheel angeschaut, weil sie entweder kleinkarierte Pipis oder heimliche Machtmenschen sind. Exzessives Rechtschreiben wird oft aus Gründen einer psychischen Störung bei sich selbst oder aus Disziplinierungsgründen bei anderen eingesetzt.
Menschen, die sich um Rechtschreibung kümmern, werden zwischendurch scheel angeschaut, weil sie entweder kleinkarierte Pipis oder heimliche Machtmenschen sind. Exzessives Rechtschreiben wird oft aus Gründen einer psychischen Störung bei sich selbst oder aus Disziplinierungsgründen bei anderen eingesetzt. Kluge Täler geben dem Hauptfluss immer einen anderen Namen als dem Tal selbst, so können Feinde abgewehrt werden, indem man sie verschickt. Wenn jemand nämlich fragt, wo die Sellrain fließt, kann man ihn verschicken, im Sellraintal nämlich fließt die Melach.
Kluge Täler geben dem Hauptfluss immer einen anderen Namen als dem Tal selbst, so können Feinde abgewehrt werden, indem man sie verschickt. Wenn jemand nämlich fragt, wo die Sellrain fließt, kann man ihn verschicken, im Sellraintal nämlich fließt die Melach. In den Hitparaden und Charts gibt es nur Sieger, was aber machen die anderen, die nicht von der Geschmackstombola nach oben gespült werden?
In den Hitparaden und Charts gibt es nur Sieger, was aber machen die anderen, die nicht von der Geschmackstombola nach oben gespült werden? Im engeren Bedeutungssinn hat der Lebenslauf mit dem Abrennen einer Strecke zu tun, und wer einmal einem Marathonisten zugesehen hat, wie er nach dem Ziel zusammenbricht, der versteht, dass es beim Lebenslauf um Leben und Tod geht.
Im engeren Bedeutungssinn hat der Lebenslauf mit dem Abrennen einer Strecke zu tun, und wer einmal einem Marathonisten zugesehen hat, wie er nach dem Ziel zusammenbricht, der versteht, dass es beim Lebenslauf um Leben und Tod geht. Keine literarische Form ist letztlich so offen und unbegrenzbar wie die Biographie, weil offensichtlich ein Lebenslauf größer ist als jede literarische Form.
Keine literarische Form ist letztlich so offen und unbegrenzbar wie die Biographie, weil offensichtlich ein Lebenslauf größer ist als jede literarische Form.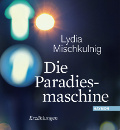 Die größten Überraschungen in einer scheinbar hochkomplexen Gesellschaft entstehen dadurch, dass die Menschen die diversen Gebrauchsanweisungen entweder gar nicht oder zu genau lesen.
Die größten Überraschungen in einer scheinbar hochkomplexen Gesellschaft entstehen dadurch, dass die Menschen die diversen Gebrauchsanweisungen entweder gar nicht oder zu genau lesen. Eine Bagatelle in der Musik ist letztlich etwas so Mickriges, dass es sich gar nicht lohnt, die Instrumente auszupacken. Im Strafrecht ist eine Bagatelle etwas, was nicht der Mühe wert ist, einem Verfahren zugeführt zu werden.
Eine Bagatelle in der Musik ist letztlich etwas so Mickriges, dass es sich gar nicht lohnt, die Instrumente auszupacken. Im Strafrecht ist eine Bagatelle etwas, was nicht der Mühe wert ist, einem Verfahren zugeführt zu werden.