Peter Paul Wiplinger, Tagtraumnotizen
 Irgendwo zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft sind die Tagträume zu Hause, die sich nicht greifen lassen, höchstens umrunden.
Irgendwo zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft sind die Tagträume zu Hause, die sich nicht greifen lassen, höchstens umrunden.
Peter Paul Wiplinger nennt seine Aufzeichnungen aus diesem täglich aufziehenden Schattenreich Tagtraumnotizen. Im ersten Anblick erinnern diese kompakten Prosazellen an schwere Keile, die in die Materie gerammt sind um entweder einen Baum zu fällen, eine Tür aufzuspreizen oder einen Stein zu sprengen. Die Texte sind nach innen spitz und nach außen stachelig gehalten, sie geben ihr Geheimnis nicht leichtfertig her, für die Lektüre braucht es einen langen Blick über die Zeilenränder hinaus und eine Ahnung von der Vergänglichkeit des ganzen Werkels, das sich Leben nennt.

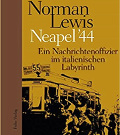 Reisebücher beschreiben meist ein Stück Geographie mit mehr oder weniger interessanten Menschen drin, eine spezielle Form ist jene, die dabei ein Stück Zeitgeschichte bereist.
Reisebücher beschreiben meist ein Stück Geographie mit mehr oder weniger interessanten Menschen drin, eine spezielle Form ist jene, die dabei ein Stück Zeitgeschichte bereist. „Liegen bleiben“ ist ein Ausdruck, der aufs Erste das Österreichische perfekt zum Ausdruck bringt. Eine Arbeit bleibt liegen, ein Beamter entschließt sich, heute liegen zu bleiben, ein Projekt bleibt liegen, Fahrzeuge bleiben liegen, etwas wird weggeworfen und bleibt liegen.
„Liegen bleiben“ ist ein Ausdruck, der aufs Erste das Österreichische perfekt zum Ausdruck bringt. Eine Arbeit bleibt liegen, ein Beamter entschließt sich, heute liegen zu bleiben, ein Projekt bleibt liegen, Fahrzeuge bleiben liegen, etwas wird weggeworfen und bleibt liegen. Ein aufregender Essay fragt nicht lange und reißt den Leser mit kurzen Denkbewegungen Oktopus-mäßig in den Schlund des Nachdenkens.
Ein aufregender Essay fragt nicht lange und reißt den Leser mit kurzen Denkbewegungen Oktopus-mäßig in den Schlund des Nachdenkens. Oft sind es diese kleinen selbstbewussten Widerspruchswörter, die in einer Erzählung als strukturierte Alternativen hervortreten. Das Wörtchen „doch“ erinnert im besten Fall an ein dynamisches Kind, welches in den Boden stampft und „doch“ schreit, um ein Begehren vorzutragen.
Oft sind es diese kleinen selbstbewussten Widerspruchswörter, die in einer Erzählung als strukturierte Alternativen hervortreten. Das Wörtchen „doch“ erinnert im besten Fall an ein dynamisches Kind, welches in den Boden stampft und „doch“ schreit, um ein Begehren vorzutragen.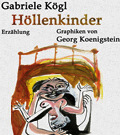 Nach einer recht einleuchtenden Vorstellung besteht der Sinn des Lebens im ständigen Erzählen dieses Lebens. Wenn alles fertig ist, setzt das Leben von sich aus den Schlusspunkt.
Nach einer recht einleuchtenden Vorstellung besteht der Sinn des Lebens im ständigen Erzählen dieses Lebens. Wenn alles fertig ist, setzt das Leben von sich aus den Schlusspunkt.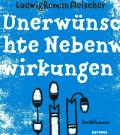 In einem geordneten System wie der Medizin, der Pädagogik oder der Literatur geht man davon aus, dass etwas beabsichtigt wird, und „daneben“ können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Nun wissen aber gewiefte Mediziner, Lehrer und Autoren, dass es besser ist, Haupt- und Nebenwirkung zu vertauschen, um das Ziel zu erreichen.
In einem geordneten System wie der Medizin, der Pädagogik oder der Literatur geht man davon aus, dass etwas beabsichtigt wird, und „daneben“ können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Nun wissen aber gewiefte Mediziner, Lehrer und Autoren, dass es besser ist, Haupt- und Nebenwirkung zu vertauschen, um das Ziel zu erreichen.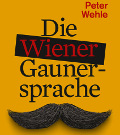 Seit Kindheitstagen träumen wir alle von einer Geheimsprache, mit der wir wichtige Dinge so verschlüsselt aussprechen können, dass uns die Freunde zuzwinkern und die „Kiwara“ blöd schauen. Die sogenannte Gaunersprache ist so eine Geheimsprache, im konkreten Fall ist sie noch zusätzlich verschlüsselt durch die Zeit, die an keiner Gaunersprache spurlos vorbeigeht.
Seit Kindheitstagen träumen wir alle von einer Geheimsprache, mit der wir wichtige Dinge so verschlüsselt aussprechen können, dass uns die Freunde zuzwinkern und die „Kiwara“ blöd schauen. Die sogenannte Gaunersprache ist so eine Geheimsprache, im konkreten Fall ist sie noch zusätzlich verschlüsselt durch die Zeit, die an keiner Gaunersprache spurlos vorbeigeht. Den besten Stoff für Literatur bietet allemal das Leben selbst und das verrückteste Glück lässt sich nur in der Literatur finden.
Den besten Stoff für Literatur bietet allemal das Leben selbst und das verrückteste Glück lässt sich nur in der Literatur finden.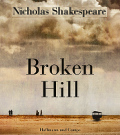 Wenn ein Ort richtig entlegen ist, fällt er mit einer Handbewegung aus Raum und Zeit. Broken Hill ist ein abgewirtschafteter Bergbau-Ort im tiefsten Australien. Mit der schrottreifen Eisenbahn ist es leichter über die Küste nach London zu gelangen als nach Sidney.
Wenn ein Ort richtig entlegen ist, fällt er mit einer Handbewegung aus Raum und Zeit. Broken Hill ist ein abgewirtschafteter Bergbau-Ort im tiefsten Australien. Mit der schrottreifen Eisenbahn ist es leichter über die Küste nach London zu gelangen als nach Sidney.