Lucas Cejpek, Du siehst Gespenster und nichts in der Minibar
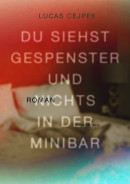 Jeder aufregende Essay ist letztlich eingezwängt zwischen den Extrempositionen der Schwarzmalerei und der Abgeschnittenheit vom erhellenden Stoff.
Jeder aufregende Essay ist letztlich eingezwängt zwischen den Extrempositionen der Schwarzmalerei und der Abgeschnittenheit vom erhellenden Stoff.
Lucas Cejpek verpackt diese Beklemmung in einen wunderbaren Titel. Einerseits wird die Schwarzmalerei relativiert mit der landläufigen Fügung „Du siehst Gespenster“, andererseits wird die desaströse Stimmung angesprochen, wenn im Hotelzimmer zwar der Kühlschrank brummt, aber nichts in der Minibar ist. Wie soll das Individuum etwas Vernünftiges denken, wenn es vom Stoff abgeschnitten ist?

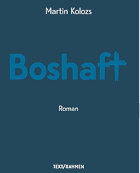 Das literarische Bermudadreieck für para-normale Fiktion ist irgendwo zwischen Edgar Allen Poe (Die Sphinx), Andre Gide (Die Verliese des Vatikan) und Ray Bradbury (Fahrenheit 451) angesiedelt.
Das literarische Bermudadreieck für para-normale Fiktion ist irgendwo zwischen Edgar Allen Poe (Die Sphinx), Andre Gide (Die Verliese des Vatikan) und Ray Bradbury (Fahrenheit 451) angesiedelt.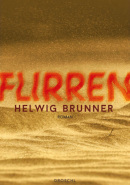 Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.
Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.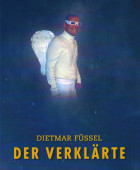 In Denksphären mit mannigfaltigen Spielregeln sind die verwendeten Begriffe oft labil wie Quanten, sie können zu Beginn eines Satzes etwas anderes bedeuten als an dessen Ende. Vor allem Theologie und Literatur werden diesem Metier zugerechnet, dessen Protagonisten oft als Schwurbler auftreten. Die Sprache hält für diese Geschichten exquisite Begriffe parat, die wie Leitpflöcke den Diskurs durch den Nebel führen. – „Der Verklärte“ ist so ein Begriff.
In Denksphären mit mannigfaltigen Spielregeln sind die verwendeten Begriffe oft labil wie Quanten, sie können zu Beginn eines Satzes etwas anderes bedeuten als an dessen Ende. Vor allem Theologie und Literatur werden diesem Metier zugerechnet, dessen Protagonisten oft als Schwurbler auftreten. Die Sprache hält für diese Geschichten exquisite Begriffe parat, die wie Leitpflöcke den Diskurs durch den Nebel führen. – „Der Verklärte“ ist so ein Begriff.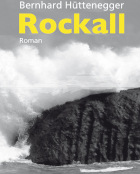 Was für ein entlegener Ort. Rockall ist ein Felsen im Nord-Atlantik, der mit knapp achthundert Quadratmetern vielleicht so groß ist wie ein passables Penthouse. Freilich präsentiert sich der Felsen als so steil, dass man als Mensch darauf kaum richtig stehen oder im Biwak liegen kann.
Was für ein entlegener Ort. Rockall ist ein Felsen im Nord-Atlantik, der mit knapp achthundert Quadratmetern vielleicht so groß ist wie ein passables Penthouse. Freilich präsentiert sich der Felsen als so steil, dass man als Mensch darauf kaum richtig stehen oder im Biwak liegen kann. Warum lassen sich die Tiere eigentlich ausrotten und abschlachten, warum tun sie nichts dagegen? – Weil sie nicht intelligent sind! Nadja Niemeyer beendet diese unintelligente Behauptung mit einem „Gegenangriff“.
Warum lassen sich die Tiere eigentlich ausrotten und abschlachten, warum tun sie nichts dagegen? – Weil sie nicht intelligent sind! Nadja Niemeyer beendet diese unintelligente Behauptung mit einem „Gegenangriff“. Utopien und Dystopien müssen den Leser mit zwei Brechstangen öffnen und bearbeiten, einmal ist es eine utopische Botschaft in Romanform, zum anderen das Aushebeln der Zeit.
Utopien und Dystopien müssen den Leser mit zwei Brechstangen öffnen und bearbeiten, einmal ist es eine utopische Botschaft in Romanform, zum anderen das Aushebeln der Zeit.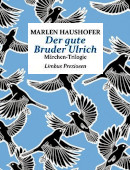 Wer einmal ein Jahrhundertbuch geschrieben hat, kann auch seine übrigen Texte nicht mehr im Schatten halten. Zwar fallen diese Texte dem Gesetz der Erinnerungsschwerkraft gehorchend ins bodenlose Vergessen, sie werden aber von Nachlasspflegern und angehenden Archivaren immer wieder hervorgeholt, gedreht und gewendet und frisch für den literarischen Verzehr paniert.
Wer einmal ein Jahrhundertbuch geschrieben hat, kann auch seine übrigen Texte nicht mehr im Schatten halten. Zwar fallen diese Texte dem Gesetz der Erinnerungsschwerkraft gehorchend ins bodenlose Vergessen, sie werden aber von Nachlasspflegern und angehenden Archivaren immer wieder hervorgeholt, gedreht und gewendet und frisch für den literarischen Verzehr paniert.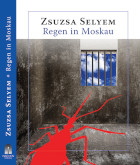 Wenn einem eine Geschichte schon Haltegriffe in Gestalt von Ortsnamen und Zeitangaben in den Beipackzettel steckt, dann sollte man diese Angaben nicht ignorieren. Diese äußeren Angaben sind kleine Guckfenster, um dadurch ins Innere der Erzählung zu schauen, die unter hohem Druck steht und wie in einem Reaktor mannigfaltige historische Prozesse ablaufen lässt.
Wenn einem eine Geschichte schon Haltegriffe in Gestalt von Ortsnamen und Zeitangaben in den Beipackzettel steckt, dann sollte man diese Angaben nicht ignorieren. Diese äußeren Angaben sind kleine Guckfenster, um dadurch ins Innere der Erzählung zu schauen, die unter hohem Druck steht und wie in einem Reaktor mannigfaltige historische Prozesse ablaufen lässt. Kultbücher haben den Vorteil, dass man sie nicht zu lesen braucht. Es genügt meist ein leichtes Nicken und das Thema geht vorbei. Anders ist es hingegen mit Pionierbüchern, diese muss man fast lesen, wenn man die Entwicklung der Literatur verstehen will. Und dann weiß man bei diesen entscheidenden Scharnier-Büchern nie, wie man sie lesen soll, mit der Erfahrung der Vergangenheit oder dem Geist der Zukunft?
Kultbücher haben den Vorteil, dass man sie nicht zu lesen braucht. Es genügt meist ein leichtes Nicken und das Thema geht vorbei. Anders ist es hingegen mit Pionierbüchern, diese muss man fast lesen, wenn man die Entwicklung der Literatur verstehen will. Und dann weiß man bei diesen entscheidenden Scharnier-Büchern nie, wie man sie lesen soll, mit der Erfahrung der Vergangenheit oder dem Geist der Zukunft?