 In der Literatur ist das Menschenfleisch unlösbar mit dem Rübezahl verknüpft, der in eine Hütte eindringt und die unsterblichen Worte ruft: Ich rieche, rieche Menschenfleisch!
In der Literatur ist das Menschenfleisch unlösbar mit dem Rübezahl verknüpft, der in eine Hütte eindringt und die unsterblichen Worte ruft: Ich rieche, rieche Menschenfleisch!
Ähnlich abrupt tritt Dietmar Füssel in die diversen Szenarien menschlicher Schwächen ein und riecht die Situationen mit kalter Lyrik-Schnauze ab. In einer Mischung aus Auszählreim, Flegel-Gedicht oder Altherren-Spucke nimmt er die jeweiligen Situationen auf die Reimschaufel und macht schön geordnete Häufchen daraus.

 Am Rand des Kontinents hören die Gespräche auf und die Geräusche dienen der Kommunikation mit dem Nichts. Auf dem Weg in das Weiße oder Schwarze dieser Leere trifft der Reporter immer wieder vereinzelte Menschen, die als Außenposten einer Erzählung angesehen werden können.
Am Rand des Kontinents hören die Gespräche auf und die Geräusche dienen der Kommunikation mit dem Nichts. Auf dem Weg in das Weiße oder Schwarze dieser Leere trifft der Reporter immer wieder vereinzelte Menschen, die als Außenposten einer Erzählung angesehen werden können. Wenn jemand abgekoppelt von allen Mitteln, die zum Leben notwendig sind, sein Dasein fristen muss, lebt er quasi an der Nullstufe der Existenz.
Wenn jemand abgekoppelt von allen Mitteln, die zum Leben notwendig sind, sein Dasein fristen muss, lebt er quasi an der Nullstufe der Existenz.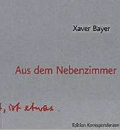 Es ist wie beim berühmten Stein, den man am Wegrand kurz wegdreht, und darunter tummelt sich ein Kosmos von Getier in voller Bewegung.
Es ist wie beim berühmten Stein, den man am Wegrand kurz wegdreht, und darunter tummelt sich ein Kosmos von Getier in voller Bewegung. Städte historischer Verdichtung sind immer auch mit Gewalt konfrontiert. Die ukrainische Stadt Lviv ist im letzten Jahrhundert stets auch ein Ort brachialer Vernichtung gewesen, so dass man Übersetzungen aus dieser Stadt gerne etwas abmildert. Aus dem „Tango des Todes“ ist im Deutschen jetzt das Proust-sachte „Im Schatten der Mohnblüte“ geworden.
Städte historischer Verdichtung sind immer auch mit Gewalt konfrontiert. Die ukrainische Stadt Lviv ist im letzten Jahrhundert stets auch ein Ort brachialer Vernichtung gewesen, so dass man Übersetzungen aus dieser Stadt gerne etwas abmildert. Aus dem „Tango des Todes“ ist im Deutschen jetzt das Proust-sachte „Im Schatten der Mohnblüte“ geworden. Nur selten gelingt es einem Helden, das abgehangene Spätlebensalter als geerdetes Kind auf einem Traktor zu verbringen und dabei die Leser zu verzücken.
Nur selten gelingt es einem Helden, das abgehangene Spätlebensalter als geerdetes Kind auf einem Traktor zu verbringen und dabei die Leser zu verzücken. Die Welt ist alles, was der Fallwind ist, sagt ein kauziger Typ über die Alpen, deren Haupt-Merkmal vielleicht der Föhn ist. Und egal wo Nord- oder Südtirol tagsüber politisch hin driften, nächtens fließt der Föhn und kratzt die Bewohner auf und bringt sie in Wallung.
Die Welt ist alles, was der Fallwind ist, sagt ein kauziger Typ über die Alpen, deren Haupt-Merkmal vielleicht der Föhn ist. Und egal wo Nord- oder Südtirol tagsüber politisch hin driften, nächtens fließt der Föhn und kratzt die Bewohner auf und bringt sie in Wallung. Bei der Schmelze verändert sich der Stoff und geht vom festen in den flüssigen Aggregatszustand über. Auch in der Poesie gibt es so etwas wie Schmelze, wenn sich ein Stoff während des Erzählens verändert und als Prosa-Lava über die Seiten fließt.
Bei der Schmelze verändert sich der Stoff und geht vom festen in den flüssigen Aggregatszustand über. Auch in der Poesie gibt es so etwas wie Schmelze, wenn sich ein Stoff während des Erzählens verändert und als Prosa-Lava über die Seiten fließt.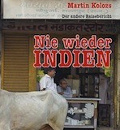 So wie man eine Reise antritt, so wird sie auch ausfallen. Am aufmerksamsten reist, wer eine Reise nur einmal machen möchte.
So wie man eine Reise antritt, so wird sie auch ausfallen. Am aufmerksamsten reist, wer eine Reise nur einmal machen möchte. Wenn Tiere mehr als eine Sache aber weniger als ein Mensch sind, muss folglich auch unser Blick auf sie heftiger als auf Sachen aber weniger intensiv als auf Menschen ausfallen.
Wenn Tiere mehr als eine Sache aber weniger als ein Mensch sind, muss folglich auch unser Blick auf sie heftiger als auf Sachen aber weniger intensiv als auf Menschen ausfallen.