Wolfgang Pollanz, Ein durch und durch durchschnittliches Leben
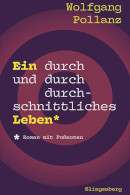 Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.
Sobald man das Mittelmaß von etwas zu ermitteln versucht, treten die Extreme und Extravaganzen unkündbar in den Vordergrund. Ein durchschnittliches Leben zu ermitteln, führt in der Literatur verlässlich zu einem Heldenepos, in dem sich die Protagonisten nicht gegen ihre wahrhaftige Bedeutung zur Wehr setzen können.
Wolfgang Pollanz beschreibt im Duktus einer Autobiographie das Leben in Österreich, wie es ein vermeintlich durchschnittlicher Protagonist auf dem steirischen Lande von den 1950er Jahren bis herauf in die Gegenwart geführt haben könnte. Denn obwohl alles mit dem Selbstbewusstsein eines Schelmenromans erzählt ist, wird für den Musiker und Schriftsteller Wolfgang Pollanz das eigene Leben wie von selbst zur eigenständigen Literatur, die sich quasi zu einem individuellen Genre entwickelt hat.

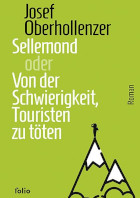 Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.
Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.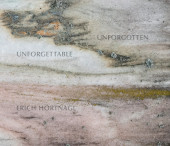 Was immer das Leben unvergessen machen kann, es gleicht einer Sanduhr, die ein paar Mal gedreht wird, ehe der Sand in der Zeit verschwunden ist.
Was immer das Leben unvergessen machen kann, es gleicht einer Sanduhr, die ein paar Mal gedreht wird, ehe der Sand in der Zeit verschwunden ist. Das Unerfüllbare / fülle ich / mit Unerfüllbarem. (16) ‒ Selten ist die Absicht der Lyrik so klar formuliert wie in der „Stunde der Wintervögel“. Dieser magische Titel kreist scheinbar um das gängige Hauptmotiv der Gegenwartslyrik, den Vögeln, in Wirklichkeit aber ist ein poetischer Teppich über das Land gelegt, aus dem wie in alten Zeiten des Teppich-Klopfens Gebrauchspartikel der unmittelbaren Gegenwart geschüttelt werden.
Das Unerfüllbare / fülle ich / mit Unerfüllbarem. (16) ‒ Selten ist die Absicht der Lyrik so klar formuliert wie in der „Stunde der Wintervögel“. Dieser magische Titel kreist scheinbar um das gängige Hauptmotiv der Gegenwartslyrik, den Vögeln, in Wirklichkeit aber ist ein poetischer Teppich über das Land gelegt, aus dem wie in alten Zeiten des Teppich-Klopfens Gebrauchspartikel der unmittelbaren Gegenwart geschüttelt werden.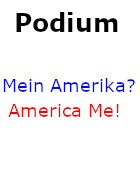 Zumindest in der Literatur, sagt man, kann es Austria mit Amerika aufnehmen. Und dann werden gleich wuchtige Beispiele von Kürnberger, Kafka, Roth und Handke genannt, worin von Europa aus ein kontinentales Weltbild von Amerika entwickelt worden ist.
Zumindest in der Literatur, sagt man, kann es Austria mit Amerika aufnehmen. Und dann werden gleich wuchtige Beispiele von Kürnberger, Kafka, Roth und Handke genannt, worin von Europa aus ein kontinentales Weltbild von Amerika entwickelt worden ist.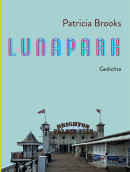 Im Idealfall beschreibt ein einziges Wort einen Kosmos voller Gefühle, Erinnerungen und Träume. In der Lyrik sind diese Zauberbegriffe oft in rätselhaften Gedichten versteckt, manchmal werden sie auf das Cover gespült und schalten dabei das Licht an für eine wundersame Imagination – Lunapark.
Im Idealfall beschreibt ein einziges Wort einen Kosmos voller Gefühle, Erinnerungen und Träume. In der Lyrik sind diese Zauberbegriffe oft in rätselhaften Gedichten versteckt, manchmal werden sie auf das Cover gespült und schalten dabei das Licht an für eine wundersame Imagination – Lunapark. Welches Werkzeug passt zu welchem Kunstwerk? – Wenn Literatur als Kunstwerk die Gegenwart erhellen soll, braucht es auch einen Blick auf das Genre, das als Medium diese Gegenwart betreut.
Welches Werkzeug passt zu welchem Kunstwerk? – Wenn Literatur als Kunstwerk die Gegenwart erhellen soll, braucht es auch einen Blick auf das Genre, das als Medium diese Gegenwart betreut. Wenn zwei lyrische Kerne als Projekte aufeinandertreffen, entsteht eine Art lyrische Kettenreaktion, die sich in einem plastischen Kunstwerk äußert. - Im Falle von OUT NOW lässt sich diese lyrische Plastizität als flugschrift N° 51 geradezu mit Händen und Augen greifen.
Wenn zwei lyrische Kerne als Projekte aufeinandertreffen, entsteht eine Art lyrische Kettenreaktion, die sich in einem plastischen Kunstwerk äußert. - Im Falle von OUT NOW lässt sich diese lyrische Plastizität als flugschrift N° 51 geradezu mit Händen und Augen greifen.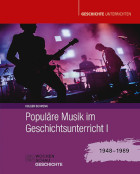 „Während historische Lieder […] fester Bestandteil der Geschichtsdidaktik geworden sind, sind die Publikationen zu populärer Musik sowie ihrem didaktischen Einsatz im Geschichtsunterricht bis lang bis auf wenige Ausnahmen eher ein Randthema gewesen, obwohl sie sowohl als Gegenstand als auch als Quelle ein hohes Lern- und Motivationspotential bieten und zur Sensibilisierung beitragen sowie unterstützend für die Förderung des Geschichtsbewusstseins sein können.“ (S. 5)
„Während historische Lieder […] fester Bestandteil der Geschichtsdidaktik geworden sind, sind die Publikationen zu populärer Musik sowie ihrem didaktischen Einsatz im Geschichtsunterricht bis lang bis auf wenige Ausnahmen eher ein Randthema gewesen, obwohl sie sowohl als Gegenstand als auch als Quelle ein hohes Lern- und Motivationspotential bieten und zur Sensibilisierung beitragen sowie unterstützend für die Förderung des Geschichtsbewusstseins sein können.“ (S. 5)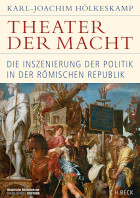 „Die ganze Welt ist eine Bühne – das ist nicht nur eine vielzitierte, ebenso universell wie beliebig verwendbare Sentenz aus William Shakespeares Wie es euch gefällt, sondern muss heute auf ganz neue Weise durchaus ernst genommen werden. Längst geht es um mehr und anderes als einen wohlfeilen programmatischen Anspruch irgendwelcher Propheten des sogenannten ‹performative turn› in den Kulturwissenschaften.“ (S. 15)
„Die ganze Welt ist eine Bühne – das ist nicht nur eine vielzitierte, ebenso universell wie beliebig verwendbare Sentenz aus William Shakespeares Wie es euch gefällt, sondern muss heute auf ganz neue Weise durchaus ernst genommen werden. Längst geht es um mehr und anderes als einen wohlfeilen programmatischen Anspruch irgendwelcher Propheten des sogenannten ‹performative turn› in den Kulturwissenschaften.“ (S. 15)