Dine Petrik, Funken. Klagen
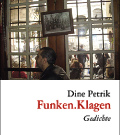 In der Lyrik ist nichts selbstverständlich, wenn man glaubt, eine Fügung würde etwas genau beschreiben, so liegt daneben eine noch genauere, die es noch genauer sagt.
In der Lyrik ist nichts selbstverständlich, wenn man glaubt, eine Fügung würde etwas genau beschreiben, so liegt daneben eine noch genauere, die es noch genauer sagt.
Dine Petrik arbeitet in einem doppelten Veredelungsprozess. Zuerst wird der Stoff poetisiert, und dort, wo scheinbar schon die Gedichte fertig sind, kommen sie noch einmal ins Galvanisierungs-Bad und erhalten eine Zeit-feste Außenhaut. Wo man bereits mit Funken schlagen in die Gewissheit gelenkt wird, kommt eine neue Perspektive hinzu, der Titel der Gedichtsammlung heißt folglich richtig „Funken.

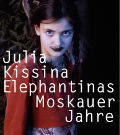 In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden die letzten Jahre des Imperiums als „Moskauer Jahre“ bezeichnet, damit kann man zeitgenössisch präzise sein und dennoch die Gefühlsdistanz zur alten Mutter Hammer-Sichel kundtun.
In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden die letzten Jahre des Imperiums als „Moskauer Jahre“ bezeichnet, damit kann man zeitgenössisch präzise sein und dennoch die Gefühlsdistanz zur alten Mutter Hammer-Sichel kundtun. Auch wenn der Kapitalismus noch so sehr darauf pocht, dass man die Welt besitzen könne, Landschaften jedenfalls lassen sich nicht besitzen, sondern nur leihen. Damit gleichen sie unseren besten Büchern in den Bibliotheken, deren Inhalt man zwar besitzen kann, wenn man ihn gelesen hat, deren Korpus aber nur geliehen ist.
Auch wenn der Kapitalismus noch so sehr darauf pocht, dass man die Welt besitzen könne, Landschaften jedenfalls lassen sich nicht besitzen, sondern nur leihen. Damit gleichen sie unseren besten Büchern in den Bibliotheken, deren Inhalt man zwar besitzen kann, wenn man ihn gelesen hat, deren Korpus aber nur geliehen ist.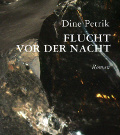 Letztlich sind viele Typen prädestiniert, sich vor der Nacht zu fürchten. Die Kinder, wenn sie mit Gruselprogramm zu Bett gebracht worden sind, die erotisch Inspirierten, wenn das Tun nicht mehr mit dem Wollen übereinstimmt, die Künstler, wenn sie in der Finsternis dem aufgeklärten Licht ihrer Werke entrückt sind.
Letztlich sind viele Typen prädestiniert, sich vor der Nacht zu fürchten. Die Kinder, wenn sie mit Gruselprogramm zu Bett gebracht worden sind, die erotisch Inspirierten, wenn das Tun nicht mehr mit dem Wollen übereinstimmt, die Künstler, wenn sie in der Finsternis dem aufgeklärten Licht ihrer Werke entrückt sind.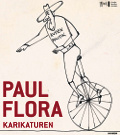 Das Publikum sieht oft etwas ganz Anderes in den Bildern, als es der Urheber vielleicht gedacht hat. So sagen die Tiroler jedenfalls zu allem, was wie eine Federzeichnung ausschaut, Karikatur, weil sie die Welt meist als Federzeichnung empfinden.
Das Publikum sieht oft etwas ganz Anderes in den Bildern, als es der Urheber vielleicht gedacht hat. So sagen die Tiroler jedenfalls zu allem, was wie eine Federzeichnung ausschaut, Karikatur, weil sie die Welt meist als Federzeichnung empfinden. Gewisse Kunsttechniken sind so knapp an die Seele herangeschneidert, dass sie in mehreren Kunstgattungen auftreten können und dabei jeweils die Psyche der Protagonisten oder die Melodie der Seele zum Klingen bringen.
Gewisse Kunsttechniken sind so knapp an die Seele herangeschneidert, dass sie in mehreren Kunstgattungen auftreten können und dabei jeweils die Psyche der Protagonisten oder die Melodie der Seele zum Klingen bringen.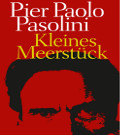 Ein Lese-Abenteuer ist es allemal, einem Klassiker beim Versickern im Sand des Vergessen-Werdens zuzuschauen, wodurch er noch einmal auf Hochglanz poliert wird.
Ein Lese-Abenteuer ist es allemal, einem Klassiker beim Versickern im Sand des Vergessen-Werdens zuzuschauen, wodurch er noch einmal auf Hochglanz poliert wird. Wie muss man kleine Begebenheiten, entlegene Landstriche, versteckte Stimmungen oder verlorengegangene Lebensentwürfe aufrüsten, dass man sie als Andeutung gerade noch erzählen kann?
Wie muss man kleine Begebenheiten, entlegene Landstriche, versteckte Stimmungen oder verlorengegangene Lebensentwürfe aufrüsten, dass man sie als Andeutung gerade noch erzählen kann? In der guten alten Pop-Musik gibt es Heroen, Götter, Glitzer, Fans und Anbetungen wie in einer handfesten Religion. Die Mythen des auftretenden Pop-Personals sind ähnlich gestrickt wie Schöpfungsberichte oder Sagen des klassischen Altertums.
In der guten alten Pop-Musik gibt es Heroen, Götter, Glitzer, Fans und Anbetungen wie in einer handfesten Religion. Die Mythen des auftretenden Pop-Personals sind ähnlich gestrickt wie Schöpfungsberichte oder Sagen des klassischen Altertums. Polaroids im klassischen Sinne sind Fotos, die ohne den Umweg über ein Labor oder einen Computer beinahe in Echtzeit aus dem Fotoapparat gespuckt werden, nachdem man abgedrückt hat.
Polaroids im klassischen Sinne sind Fotos, die ohne den Umweg über ein Labor oder einen Computer beinahe in Echtzeit aus dem Fotoapparat gespuckt werden, nachdem man abgedrückt hat.