Leopold Federmair, Hiroshima Capriccios
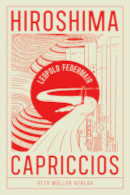 Capriccio bezeichnet den absichtlichen, lustvollen Regelverstoß der akademischen Normen, ohne die Norm außer Kraft zu setzen.
Capriccio bezeichnet den absichtlichen, lustvollen Regelverstoß der akademischen Normen, ohne die Norm außer Kraft zu setzen.
Leopold Federmair benützt für seine Notizen und Mikro-Essays demütig das Genre „Capriccio“, womit er die japanische Kultur aus der Sicht eines Österreichers als Abweichung beschreiben kann, ohne dadurch in der einen oder anderen Kultur herablassend zu wirken. Bei Aufzeichnungen zwischen den Kulturen besteht nämlich die eine Gefahr darin, dass man sich anbiedert, die andere, dass man sich über sie hinwegsetzt. Aus diesem Grund sind die Hiroshima-Texte vorne als Rahmen erklärt und hinten als Glossar.

 Von Forschenden kennen wir meist nur ihre Ergebnisse, Reisen und Laborberichte. Nur selten gelingt es uns Lesenden, in ihre Köpfe zu schauen um zu erfahren, wie sie ticken. Und stimmt es wirklich, dass sie für sich alle eine Geheimsprache verwenden?
Von Forschenden kennen wir meist nur ihre Ergebnisse, Reisen und Laborberichte. Nur selten gelingt es uns Lesenden, in ihre Köpfe zu schauen um zu erfahren, wie sie ticken. Und stimmt es wirklich, dass sie für sich alle eine Geheimsprache verwenden?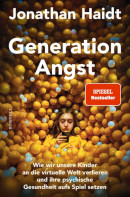 „Generation Angst ist ein Buch, in dem es darum geht, wie wir das menschliche Leben für Menschen aller Generationen zurückerobern können.“
„Generation Angst ist ein Buch, in dem es darum geht, wie wir das menschliche Leben für Menschen aller Generationen zurückerobern können.“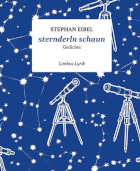 „olle san in ihrn hirn alan“ (49) – Gedichte sind wahrscheinlich ein Überdruckventil, um den Dampf der Solitude ein wenig abzulassen.
„olle san in ihrn hirn alan“ (49) – Gedichte sind wahrscheinlich ein Überdruckventil, um den Dampf der Solitude ein wenig abzulassen.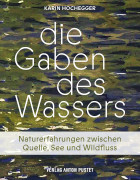 „Das Wasser begegnet uns als Rätsel. Es hat keine Form, kann aber jede Form annehmen. Es lässt sich berühren, aber nicht halten. Es rinnt durch die Finger, als wäre es ohne Substanz, und dennoch gilt es als Grundlage des Lebens auf diesem Planeten. Wissenschaftlich ausgedrückt: Es besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Das Molekül H2O, eine im Prinzip simpel erscheinende chemische Verbindung, die aber enorme Komplexität aufweist und alle klimatischen und biologischen Prozesse auf der Erde prägt.“ (S. 12)
„Das Wasser begegnet uns als Rätsel. Es hat keine Form, kann aber jede Form annehmen. Es lässt sich berühren, aber nicht halten. Es rinnt durch die Finger, als wäre es ohne Substanz, und dennoch gilt es als Grundlage des Lebens auf diesem Planeten. Wissenschaftlich ausgedrückt: Es besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Das Molekül H2O, eine im Prinzip simpel erscheinende chemische Verbindung, die aber enorme Komplexität aufweist und alle klimatischen und biologischen Prozesse auf der Erde prägt.“ (S. 12)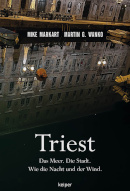 Die großen Porträts über Städte berichten nicht von den Umtrieben der Helden darin, sondern von den Anreisen, Annäherungen und Fluchten in deren Hinterland. Mike Markart und Martin G. Wanko erzählen von der magischen Stadt „Triest“ aus einer steirischen Hinterlandperspektive heraus. Die konnotierten Träume zum schroffen „Triest“ bestehen aus Meer, Stadt, Nacht und Wind.
Die großen Porträts über Städte berichten nicht von den Umtrieben der Helden darin, sondern von den Anreisen, Annäherungen und Fluchten in deren Hinterland. Mike Markart und Martin G. Wanko erzählen von der magischen Stadt „Triest“ aus einer steirischen Hinterlandperspektive heraus. Die konnotierten Träume zum schroffen „Triest“ bestehen aus Meer, Stadt, Nacht und Wind.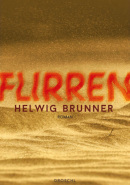 Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.
Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.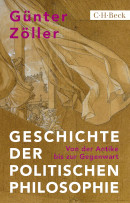 „Der folgende Abriss der (westlichen) politischen Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der klassischen Antike über das christlich geprägte Mittelalter bis zur Neuzeit und zu den jüngeren und jüngsten Entwicklungen stellt repräsentative philosophische Positionen zu den Formen und Normen der politischen Gemeinschaft in den jeweiligen Kontext von Staat und Gesellschaft. Durch die Verbindung von politischer Philosophie mit politischer Geschichte soll das philosophische Denken in seinen Zeitbezügen erhellt werden …“ (S. 7)
„Der folgende Abriss der (westlichen) politischen Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der klassischen Antike über das christlich geprägte Mittelalter bis zur Neuzeit und zu den jüngeren und jüngsten Entwicklungen stellt repräsentative philosophische Positionen zu den Formen und Normen der politischen Gemeinschaft in den jeweiligen Kontext von Staat und Gesellschaft. Durch die Verbindung von politischer Philosophie mit politischer Geschichte soll das philosophische Denken in seinen Zeitbezügen erhellt werden …“ (S. 7)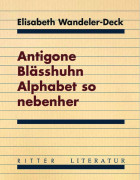 Literatur ist jene dünne Haut, die sich schützend zwischen Ordnung und Unordnung stellt. Ohne sie gäbe es weder das eine noch das andere, folglich nichts. Die Literatur erschafft somit die Welt, wie wir sie uns vorstellen.
Literatur ist jene dünne Haut, die sich schützend zwischen Ordnung und Unordnung stellt. Ohne sie gäbe es weder das eine noch das andere, folglich nichts. Die Literatur erschafft somit die Welt, wie wir sie uns vorstellen.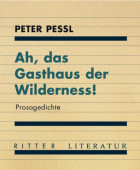 Selbst für Leseprofis sind Bücher manchmal vorerst verschlossen wie eine Nuss, man trägt sie als Krähe ein paarmal in die Luft, ehe sie dann aufgeht, wenn man sie richtig zu Boden fallen lässt. Andere nehmen den Text als Stein von Sisyphus und beginnen mit dem Rollen. Die dritten beginnen mit der Einbegleitung, in der letztlich alles drin steht, um in den Text eintreten zu dürfen.
Selbst für Leseprofis sind Bücher manchmal vorerst verschlossen wie eine Nuss, man trägt sie als Krähe ein paarmal in die Luft, ehe sie dann aufgeht, wenn man sie richtig zu Boden fallen lässt. Andere nehmen den Text als Stein von Sisyphus und beginnen mit dem Rollen. Die dritten beginnen mit der Einbegleitung, in der letztlich alles drin steht, um in den Text eintreten zu dürfen.