Jörn Birkholz, Der Ausbruch
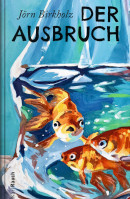 Das Wort „plötzlich“ leitet in der Literatur oft einen Ausbruch ein. Kluge Leser wissen das und blättern im Roman oft von plötzlich zu plötzlich, damit ihnen ja kein Ausbruch als Vulkan, Seuche oder Lebensplanung entgeht.
Das Wort „plötzlich“ leitet in der Literatur oft einen Ausbruch ein. Kluge Leser wissen das und blättern im Roman oft von plötzlich zu plötzlich, damit ihnen ja kein Ausbruch als Vulkan, Seuche oder Lebensplanung entgeht.
Jörn Birkholz legt die seelische Fläche, aus der sein Held Max zum Ausbruch getrieben werden soll, ziemlich tief und bedürfnislos. Als Archivar behandelt er zwar aufregende Lebensschicksale eingelagerter Helden, gerät dabei aber selbst in einen scheinbar ereignislosen bürokratischen Schlaf.

 Markante Buchtitel haben oft das Zeug dazu, unerwartet eine ganze Epoche zu beschreiben. Der Gesellschafts-Thriller „Flüchtiges Spiel“ fasst diese Verdunstung von Beziehungen, den oberflächlichen Umgang mit der Wahrheit und die Selbstauflösung von Regeln während des Spiels zu einer Stimmung zusammen, die über der Business-Welt Österreichs zu liegen scheint.
Markante Buchtitel haben oft das Zeug dazu, unerwartet eine ganze Epoche zu beschreiben. Der Gesellschafts-Thriller „Flüchtiges Spiel“ fasst diese Verdunstung von Beziehungen, den oberflächlichen Umgang mit der Wahrheit und die Selbstauflösung von Regeln während des Spiels zu einer Stimmung zusammen, die über der Business-Welt Österreichs zu liegen scheint.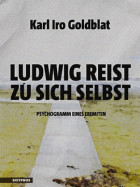 Das Aufregende am Reisen ohne Wiederkehr besteht darin, dass man mit einem einzigen Besuch im Reisebüro auskommt. Reklamationen und Schadensmeldungen sind keine Optionen, weil es keinen Vollstreckungsort gibt, außer im Innersten seiner selbst.
Das Aufregende am Reisen ohne Wiederkehr besteht darin, dass man mit einem einzigen Besuch im Reisebüro auskommt. Reklamationen und Schadensmeldungen sind keine Optionen, weil es keinen Vollstreckungsort gibt, außer im Innersten seiner selbst.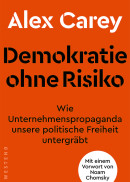 „Seit sechzig Jahren werden in den USA Propagandatechniken entwickelt und eingesetzt, mit denen erreicht wird, dass der einfache Mann zwar der Zwangsherrschaft des politischen Despotismus zu entkommen vermag, aber dennoch in kontrollierbarer Weise im Dienste anderer Interessen als seiner eigenen steht.“ (S. 48)
„Seit sechzig Jahren werden in den USA Propagandatechniken entwickelt und eingesetzt, mit denen erreicht wird, dass der einfache Mann zwar der Zwangsherrschaft des politischen Despotismus zu entkommen vermag, aber dennoch in kontrollierbarer Weise im Dienste anderer Interessen als seiner eigenen steht.“ (S. 48)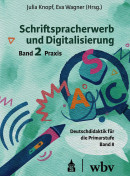 „Der Praxisband, den Sie in Händen halten, […] skizziert […] Herausforderungen und Potenziale digitaler Medien im Schriftspracherwerb. Dazu wird unter anderem ein Blick in die aktuelle Schulpraxis geworfen und der Ist-Stand der Digitalisierung festgestellt. Auch eine Bestandsaufnahme digitaler Angebote nehmen wir vor, sodass ausgewählte Apps auf eine Eignung für den Schriftspracherwerb hin untersucht werden. Zudem werfen wir die Frage auf, wie hybride Lernsettings im Schriftspracherwerb aussehen können, und welche Potenziale sich hieraus ergeben.“ (S. 2)
„Der Praxisband, den Sie in Händen halten, […] skizziert […] Herausforderungen und Potenziale digitaler Medien im Schriftspracherwerb. Dazu wird unter anderem ein Blick in die aktuelle Schulpraxis geworfen und der Ist-Stand der Digitalisierung festgestellt. Auch eine Bestandsaufnahme digitaler Angebote nehmen wir vor, sodass ausgewählte Apps auf eine Eignung für den Schriftspracherwerb hin untersucht werden. Zudem werfen wir die Frage auf, wie hybride Lernsettings im Schriftspracherwerb aussehen können, und welche Potenziale sich hieraus ergeben.“ (S. 2)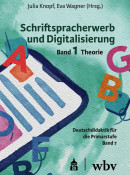 „Der Theorieband, den Sie in Händen halten, beleuchtet zunächst die Herausforderungen des Schriftspracherwerbs unter den Bedingungen der Digitalität. Er lädt Sie ein, die Schlüsselkompetenzen Lesen und Schreiben neu zu denken. Dabei widmen wir uns intensiv den Lernvoraussetzungen, frühen Sprach- und Schrifterfahrungen sowie der nach wie vor bedeutsamen Rolle des Handschreibens. Auch die Frage, wie wir Lernkräfte bestmöglich auf diese neuen Herausforderungen vorbereiten können, lassen wir nicht außen vor.“ (S. 2)
„Der Theorieband, den Sie in Händen halten, beleuchtet zunächst die Herausforderungen des Schriftspracherwerbs unter den Bedingungen der Digitalität. Er lädt Sie ein, die Schlüsselkompetenzen Lesen und Schreiben neu zu denken. Dabei widmen wir uns intensiv den Lernvoraussetzungen, frühen Sprach- und Schrifterfahrungen sowie der nach wie vor bedeutsamen Rolle des Handschreibens. Auch die Frage, wie wir Lernkräfte bestmöglich auf diese neuen Herausforderungen vorbereiten können, lassen wir nicht außen vor.“ (S. 2)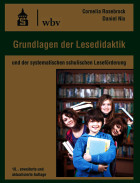 „Wegen der Notwendigkeit zur Differenzierung im Feld der Leseförderung wollen wir mit dem vorliegenden Buch zu einem detailorientierten Blick auf die Belange der verschiedenen Gruppen von Heranwachsenden anregen und die Grundlagen dafür bereitstellen. Mit dem Begriff der »systematischen Leseförderung« im Titel bezeichnen wir ein Konzept, das spezifische Leseschwierigkeiten der Schülerschaft in ein ausdifferenziertes Modell von Lesekompetenz einordnet und vor diesem Hintergrund passende Fördermethoden zu den verschiedenen Teilbereichen des Lesens empfiehlt.“ (S. 9)
„Wegen der Notwendigkeit zur Differenzierung im Feld der Leseförderung wollen wir mit dem vorliegenden Buch zu einem detailorientierten Blick auf die Belange der verschiedenen Gruppen von Heranwachsenden anregen und die Grundlagen dafür bereitstellen. Mit dem Begriff der »systematischen Leseförderung« im Titel bezeichnen wir ein Konzept, das spezifische Leseschwierigkeiten der Schülerschaft in ein ausdifferenziertes Modell von Lesekompetenz einordnet und vor diesem Hintergrund passende Fördermethoden zu den verschiedenen Teilbereichen des Lesens empfiehlt.“ (S. 9)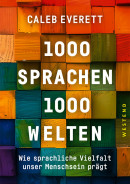 „Während also die in diesem Buch besprochenen Erkenntnisse direkt oder indirekt mit Sprachen zu tun haben, sind die meisten von ihnen deshalb bemerkenswert, weil sie sich auf andere Aspekte des menschlichen Denkens und Verhaltens beziehen. In diesem Sinn ist dies nicht ein Buch über Linguistik an sich. Es ist vielmehr ein Buch darüber […] wie Menschen denken, wenn sie sprechen, und in manchen Fällen, wie sie denken, wenn sie nicht sprechen.“ (S. 18)
„Während also die in diesem Buch besprochenen Erkenntnisse direkt oder indirekt mit Sprachen zu tun haben, sind die meisten von ihnen deshalb bemerkenswert, weil sie sich auf andere Aspekte des menschlichen Denkens und Verhaltens beziehen. In diesem Sinn ist dies nicht ein Buch über Linguistik an sich. Es ist vielmehr ein Buch darüber […] wie Menschen denken, wenn sie sprechen, und in manchen Fällen, wie sie denken, wenn sie nicht sprechen.“ (S. 18)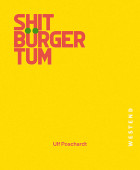 „Warum dieses Buch mit diesem Titel? Das kann man polemisch verstehen. Oder aber als eine notwendige Diskursverschiebung, um mit unverstellter Respektlosigkeit zu signalisieren, dass ein Teil des Bürgertums den Respekt, der ihm entgegengebracht wird, zur Unterminierung freiheitlicher Grundlagen des Westens genutzt hat.“ (S. 7)
„Warum dieses Buch mit diesem Titel? Das kann man polemisch verstehen. Oder aber als eine notwendige Diskursverschiebung, um mit unverstellter Respektlosigkeit zu signalisieren, dass ein Teil des Bürgertums den Respekt, der ihm entgegengebracht wird, zur Unterminierung freiheitlicher Grundlagen des Westens genutzt hat.“ (S. 7)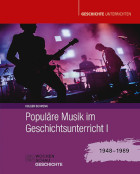 „Während historische Lieder […] fester Bestandteil der Geschichtsdidaktik geworden sind, sind die Publikationen zu populärer Musik sowie ihrem didaktischen Einsatz im Geschichtsunterricht bis lang bis auf wenige Ausnahmen eher ein Randthema gewesen, obwohl sie sowohl als Gegenstand als auch als Quelle ein hohes Lern- und Motivationspotential bieten und zur Sensibilisierung beitragen sowie unterstützend für die Förderung des Geschichtsbewusstseins sein können.“ (S. 5)
„Während historische Lieder […] fester Bestandteil der Geschichtsdidaktik geworden sind, sind die Publikationen zu populärer Musik sowie ihrem didaktischen Einsatz im Geschichtsunterricht bis lang bis auf wenige Ausnahmen eher ein Randthema gewesen, obwohl sie sowohl als Gegenstand als auch als Quelle ein hohes Lern- und Motivationspotential bieten und zur Sensibilisierung beitragen sowie unterstützend für die Förderung des Geschichtsbewusstseins sein können.“ (S. 5)