Frieda Norka, Rückkehr ins Kinderseelen-KZ
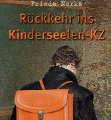
Die Logik in der Literatur ist eine andere als jene in der Forensik, Psychiatrie oder Pädagogik. Um dem Phänomen Schulmassaker ein wenig auf die Spur zu kommen, hat deshalb Frieda Norka die Form der fiktiven Dokumentation gewählt.
Was im lateinamerikanischen Raum literarisch durchaus üblich ist, stellt in unserer Lesekultur nach wie vor eine Besonderheit dar, weshalb man sich die drei Schritte der vorliegenden Dokumentation vor der Lektüre vergegenwärtigen sollte.




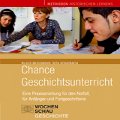 Viele verbinden mit Geschichtsunterricht das lernen und abfragen von Daten, Ereignissen rund um große historische Persönlichkeiten oder mächtige Staaten. Aber das muss nicht so sein und soll auch nicht so sein.
Viele verbinden mit Geschichtsunterricht das lernen und abfragen von Daten, Ereignissen rund um große historische Persönlichkeiten oder mächtige Staaten. Aber das muss nicht so sein und soll auch nicht so sein.



 Wohl selten wird eine Unterrichtsform in der Theorie so gelobt, wie in der Praxis vernachlässigt wie die Gruppenarbeit im Schulunterricht.
Wohl selten wird eine Unterrichtsform in der Theorie so gelobt, wie in der Praxis vernachlässigt wie die Gruppenarbeit im Schulunterricht.