Rudolf Lasselsberger, Junihitze
 Was geschieht mit all den Nachrichten, die ununterbrochen aus dem Netz, TV und aus Zeitungen fallen? – Sie kondensieren zu Junihitze, die über ein Kippfenster zwischen dumpfer Wohnung und dampfender Terrasse hin und her schwebt. Sie macht den Helden schlaflos und schwindlig.
Was geschieht mit all den Nachrichten, die ununterbrochen aus dem Netz, TV und aus Zeitungen fallen? – Sie kondensieren zu Junihitze, die über ein Kippfenster zwischen dumpfer Wohnung und dampfender Terrasse hin und her schwebt. Sie macht den Helden schlaflos und schwindlig.
Der Held in „Junihitze“ von Rudolf Lasselsberger ist so geschafft, dass er die meiste Zeit als Doppelspitze auftreten muss. In einem dialektischen Set ähnlich Wladimir und Estragon in Samuel Becketts Warten auf Godot treten Franz und sein Ich auf, indem sie jeweils sich selbst in einem bestärkenden Monolog Seufzer, Abnormitäten und Störungen zuraunen.

 In der Bezirksstadt Gmünd klettert am Friedhof ein Nackter auf das Dach des Mausoleums und wartet auf seine Abführung. Die freiwillige Feuerwehr breitet zur Vorsicht das Sprungtuch aus, aber der Held lässt sich manuell retten und wird nach Wien in die Psychiatrie gebracht, wo alsbald die Diagnose fällt: „Der Nackte am Friedhof war irr.“ (23)
In der Bezirksstadt Gmünd klettert am Friedhof ein Nackter auf das Dach des Mausoleums und wartet auf seine Abführung. Die freiwillige Feuerwehr breitet zur Vorsicht das Sprungtuch aus, aber der Held lässt sich manuell retten und wird nach Wien in die Psychiatrie gebracht, wo alsbald die Diagnose fällt: „Der Nackte am Friedhof war irr.“ (23)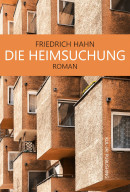 Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“
Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“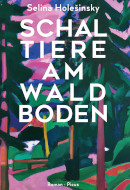 Ein Dorf ist in der Fiktion ein gern gesehener Ort, um darin Idylle, Schrecken, Wokeness oder Klimaschutz in Szene zu setzen. Mit Wimmelbildern der Kindheit wird dieser Ort gerne als analoge Wunderwelt dargestellt, worin sich die erwachsen gewordenen Kinder später einmal zurückziehen werden. Die Wirklichkeit ist freilich auch in Romanen alles andere als eine heile Welt.
Ein Dorf ist in der Fiktion ein gern gesehener Ort, um darin Idylle, Schrecken, Wokeness oder Klimaschutz in Szene zu setzen. Mit Wimmelbildern der Kindheit wird dieser Ort gerne als analoge Wunderwelt dargestellt, worin sich die erwachsen gewordenen Kinder später einmal zurückziehen werden. Die Wirklichkeit ist freilich auch in Romanen alles andere als eine heile Welt.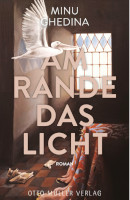 Kunst kann zur Erbkrankheit werden, wenn man als Kind im Licht großer Künstlereltern aufwachsen muss. Minu Ghedina spielt im Künstlerroman „Am Rande das Licht“ mit dem Wechselspiel von eigener Entwicklung und allgemeinem Anspruch in der Gesellschaft. Wie lässt sich der Rand eines Bildes ausleuchten, ohne dass das Auge vom Bannstrahl der mediokren Mitte verbrannt wird?
Kunst kann zur Erbkrankheit werden, wenn man als Kind im Licht großer Künstlereltern aufwachsen muss. Minu Ghedina spielt im Künstlerroman „Am Rande das Licht“ mit dem Wechselspiel von eigener Entwicklung und allgemeinem Anspruch in der Gesellschaft. Wie lässt sich der Rand eines Bildes ausleuchten, ohne dass das Auge vom Bannstrahl der mediokren Mitte verbrannt wird? Jeder Auftritt kann das Ende oder den Anfang bedeuten. – Jenseits aller Geschichtsschreibung sind es die Hebammen, die in einem Tal das Leben auf die Welt bringen oder den Tod dokumentieren.
Jeder Auftritt kann das Ende oder den Anfang bedeuten. – Jenseits aller Geschichtsschreibung sind es die Hebammen, die in einem Tal das Leben auf die Welt bringen oder den Tod dokumentieren. Fernweh irritiert in der Literatur die Helden doppelt. Zum einen können sie keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil sie mit ihrer Sehnsucht schon weit weg sind, zum anderen wird die Realität bedrückend, weil sie als unmittelbare Umgebung das Gegenteil von Fernweh ist.
Fernweh irritiert in der Literatur die Helden doppelt. Zum einen können sie keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil sie mit ihrer Sehnsucht schon weit weg sind, zum anderen wird die Realität bedrückend, weil sie als unmittelbare Umgebung das Gegenteil von Fernweh ist.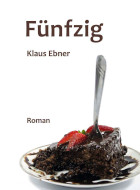 Am Morgen wacht der Erzähler auf wie der Käfer in der Verwandlung von Franz Kafka und stellt fest, dass sein Körper fünfzig Jahresringe hat. Heute sollen Geburtstagsfeiern losgehen, aber der Held ist wie gelähmt von seinem eigenen Leben und bleibt regungslos liegen, während sein Gehirn fünfzig Jahre abarbeitet. Klaus Ebner findet einen makabren Zugang, ein halbes Jahrhundert „Eigenleben“ als historisches Gesellschaftsgemälde gespiegelt im kleinen Einzelkopf originär darzustellen.
Am Morgen wacht der Erzähler auf wie der Käfer in der Verwandlung von Franz Kafka und stellt fest, dass sein Körper fünfzig Jahresringe hat. Heute sollen Geburtstagsfeiern losgehen, aber der Held ist wie gelähmt von seinem eigenen Leben und bleibt regungslos liegen, während sein Gehirn fünfzig Jahre abarbeitet. Klaus Ebner findet einen makabren Zugang, ein halbes Jahrhundert „Eigenleben“ als historisches Gesellschaftsgemälde gespiegelt im kleinen Einzelkopf originär darzustellen.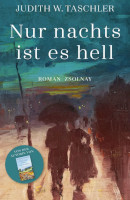 „Geschichte erzählt als Gutenachtgeschichte für Erwachsene“ – mit dieser frischen Leseempfehlung ermuntern einander die Fans von Judith Taschler, ihre neue Familiensaga zu lesen.
„Geschichte erzählt als Gutenachtgeschichte für Erwachsene“ – mit dieser frischen Leseempfehlung ermuntern einander die Fans von Judith Taschler, ihre neue Familiensaga zu lesen.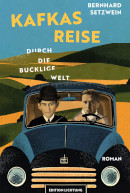 Aufregende Vorstellung: Franz Kafka hat 1924 seinen Tod nur vorgetäuscht, ist untergetaucht, hat die Nazis überlebt und erscheint nach 1945 in Meran, wo er im Apollo-Kino Karten abreißt. Als Qualifikation für diese Tätigkeit dient ihm die eigene Erzählung vom Türhüter, welcher bekanntlich streng darauf achtet, dass niemand Falscher das Gebäude betritt.
Aufregende Vorstellung: Franz Kafka hat 1924 seinen Tod nur vorgetäuscht, ist untergetaucht, hat die Nazis überlebt und erscheint nach 1945 in Meran, wo er im Apollo-Kino Karten abreißt. Als Qualifikation für diese Tätigkeit dient ihm die eigene Erzählung vom Türhüter, welcher bekanntlich streng darauf achtet, dass niemand Falscher das Gebäude betritt.