Helwig Brunner, Flirren
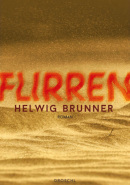 Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.
Ein guter Zukunftsroman lässt sich mit der Hochrechnung für einen Wahlabend vergleichen, die Stimmen sind abgegeben und werden ausgezählt, die Spannung steigt, und das Ergebnis wird mit der Prognose halbwegs übereinstimmen.
Helwig Brunner arbeitet mit seinem beruflichen Standbein in einem ökologischen Planungsbüro, während er sich als Schriftsteller mit dem Spielbein für „klimarelevante Desaster“ interessiert. Mit dieser Beidbeinigkeit ist auch der Held des Romans „Flirren“ ausgestattet, der von sich sagt, er sei „doppelt gefordert als schreibender Wissenschaftler und forschender Literat“. (63) Der Erkenntnisgewinn aus wissenschaftlichen Versuchsreihen und assoziativen Fiktionen ist wohl auch das geheime Thema des Romans.

 Wenn keine Bedürfnisse mehr da sind, hat man sie entweder selbst erfüllt, oder sie sind von sich aus abgehauen und haben die bisherigen Bedürfnisträger entleert zurückgelassen.
Wenn keine Bedürfnisse mehr da sind, hat man sie entweder selbst erfüllt, oder sie sind von sich aus abgehauen und haben die bisherigen Bedürfnisträger entleert zurückgelassen. Mutterliebe, Mutterschutz, Mutterwitz – mit allem ist in der Literatur zu rechnen. Aber Mutternichts? Ein irritierender Titel wie alles, bei dem das Nichts die Hauptrolle spielt. Christine Vescoli versucht sich an einem erzählerischen Kunststück, sie lässt eine Ich-Erzählerin über die Mutter reflektieren. Und obwohl es in der Erinnerungsliteratur hunderte von Schablonen für Mutter-Gedenken gibt, steht sie vor dem Nichts. „Mutter zieht sich ins Nichts zurück.“ (7)
Mutterliebe, Mutterschutz, Mutterwitz – mit allem ist in der Literatur zu rechnen. Aber Mutternichts? Ein irritierender Titel wie alles, bei dem das Nichts die Hauptrolle spielt. Christine Vescoli versucht sich an einem erzählerischen Kunststück, sie lässt eine Ich-Erzählerin über die Mutter reflektieren. Und obwohl es in der Erinnerungsliteratur hunderte von Schablonen für Mutter-Gedenken gibt, steht sie vor dem Nichts. „Mutter zieht sich ins Nichts zurück.“ (7) Der Dichter ist in die Berge abgehauen und gilt als verschollen, das Publikum ist ungeduldig, es hat zwei Bücher über schwere Helden-Entgleisung gelesen und will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Die Heldin „Blumberg 3“ sitzt in der Psychiatrie und und bietet in hellen Momenten an, ihr kriminelles Leben fertig zu erzählen. – Eine ideale Ausgangsposition für einen Roman, als ein Verleger den erlösenden Schreibauftrag vergibt, um endlich alle von der Last der nicht-erzählten Geschichte zu erlösen.
Der Dichter ist in die Berge abgehauen und gilt als verschollen, das Publikum ist ungeduldig, es hat zwei Bücher über schwere Helden-Entgleisung gelesen und will wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Die Heldin „Blumberg 3“ sitzt in der Psychiatrie und und bietet in hellen Momenten an, ihr kriminelles Leben fertig zu erzählen. – Eine ideale Ausgangsposition für einen Roman, als ein Verleger den erlösenden Schreibauftrag vergibt, um endlich alle von der Last der nicht-erzählten Geschichte zu erlösen.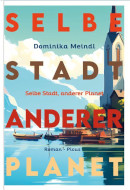 Wenn das gesellschaftliche Leben eine Inszenierung ist, muss dann nicht auch das Individuum sich selbst inszenieren? Macht es einen Unterschied, ob eine Fassade historisch gewachsen oder von einer KI gestaltet vor der Selfie-Kamera auftaucht? Ist ein absolutes System wie die Volksrepublik China vielleicht ähnlich organisiert wie die für den Tourismus ausgereizte Region rund um Hallstatt?
Wenn das gesellschaftliche Leben eine Inszenierung ist, muss dann nicht auch das Individuum sich selbst inszenieren? Macht es einen Unterschied, ob eine Fassade historisch gewachsen oder von einer KI gestaltet vor der Selfie-Kamera auftaucht? Ist ein absolutes System wie die Volksrepublik China vielleicht ähnlich organisiert wie die für den Tourismus ausgereizte Region rund um Hallstatt? Wenn jemand eine wortlose Kindheit erfahren hat, wie soll er später davon erzählen? Robert Kleindienst nimmt sich das Schicksal seines Vaters zu Herzen, der einst ziemlich wortlos im Tiroler Oberland bei einer Pflegefamilie aufgenommen und bald darauf in die berüchtigte Bubenburg im Zillertal gesteckt worden ist. Später in Salzburg ist er dann ein geschätzter Musiker geworden, der den Ton der Wortlosigkeit beim Publikum getroffen hat. Offensichtlich lässt sich die Sprachlosigkeit der Nachkriegszeit später mit Musik überwinden.
Wenn jemand eine wortlose Kindheit erfahren hat, wie soll er später davon erzählen? Robert Kleindienst nimmt sich das Schicksal seines Vaters zu Herzen, der einst ziemlich wortlos im Tiroler Oberland bei einer Pflegefamilie aufgenommen und bald darauf in die berüchtigte Bubenburg im Zillertal gesteckt worden ist. Später in Salzburg ist er dann ein geschätzter Musiker geworden, der den Ton der Wortlosigkeit beim Publikum getroffen hat. Offensichtlich lässt sich die Sprachlosigkeit der Nachkriegszeit später mit Musik überwinden.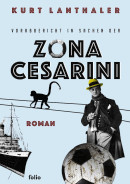 Eine Biographie wird umso genauer, je mehr Abschweifmöglichkeiten und Seitenthemen sich entlang des Heldencharakters entwickeln.
Eine Biographie wird umso genauer, je mehr Abschweifmöglichkeiten und Seitenthemen sich entlang des Heldencharakters entwickeln.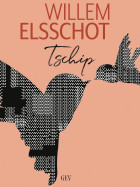 Selbst ein Klassiker muss ununterbrochen gepflegt und gegen das Vergessen gebürstet werden. Aufwändig wird diese Pflege, wenn es dazu einer Übersetzung bedarf, die den Ansprüchen von Zeitgeist und Sprachentwicklung entspricht.
Selbst ein Klassiker muss ununterbrochen gepflegt und gegen das Vergessen gebürstet werden. Aufwändig wird diese Pflege, wenn es dazu einer Übersetzung bedarf, die den Ansprüchen von Zeitgeist und Sprachentwicklung entspricht.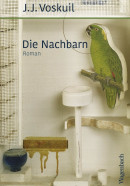 Trabanten veredeln das Muttergestirn, indem sie unermüdlich darum herumkreisen. In der Literatur veredeln posthume Editionen oft das Hauptwerk, indem sie sich ungeniert als pfiffige Text-Trabanten ausgeben.
Trabanten veredeln das Muttergestirn, indem sie unermüdlich darum herumkreisen. In der Literatur veredeln posthume Editionen oft das Hauptwerk, indem sie sich ungeniert als pfiffige Text-Trabanten ausgeben.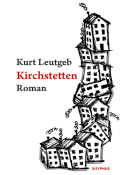 Kurt Leutgeb geht in seinem Roman „Kirchstetten“ davon aus, dass nichts eindeutig ist. Das beginnt schon mit dem Ort Kirchstetten, der dreimal rund um Wien vorkommt und ständig verwechselt wird. Damit diese Orte wenigstens historisch unverwechselbar werden, verpasst ihnen der Autor jeweils eine einmalige Geschichte.
Kurt Leutgeb geht in seinem Roman „Kirchstetten“ davon aus, dass nichts eindeutig ist. Das beginnt schon mit dem Ort Kirchstetten, der dreimal rund um Wien vorkommt und ständig verwechselt wird. Damit diese Orte wenigstens historisch unverwechselbar werden, verpasst ihnen der Autor jeweils eine einmalige Geschichte.