Rachel Cusk, Der andere Ort
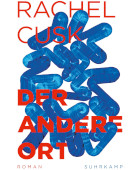 Wie ernsthaft kann ein Roman gemeint sein, wenn gleich zu Beginn der Teufel auftaucht und die Erzählerin in einem Pariser Vorortzug zu stalken beginnt?
Wie ernsthaft kann ein Roman gemeint sein, wenn gleich zu Beginn der Teufel auftaucht und die Erzählerin in einem Pariser Vorortzug zu stalken beginnt?
Diesen Teufel sollte man ernst, wenn nicht gar wörtlich nehmen, denn er stammt von Rachel Cusk. Soeben hat sie die lesende Gesellschaftsschicht in Schwingung gebracht mit ihren Romanen über die „Unwirklichkeit“ zwischen den Geschlechtern, die letztlich an den Kollateralschäden ihrer Beziehungen ersticken.

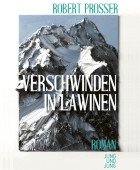 Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus davon abhängig, dass er auch von jenen mitgetragen wird, die ihm am liebsten aus dem Weg gehen. Ähnlich dem Sozialismus in der DDR ist der Tourismus in den Alpen eine Lebensform, die mit „IM“s im Dorfleben überwacht und eingefordert wird.
Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus davon abhängig, dass er auch von jenen mitgetragen wird, die ihm am liebsten aus dem Weg gehen. Ähnlich dem Sozialismus in der DDR ist der Tourismus in den Alpen eine Lebensform, die mit „IM“s im Dorfleben überwacht und eingefordert wird.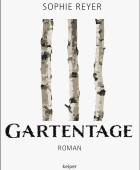 In einem Buchhändlerwitz heißt es, wenn im Frühjahr und Herbst die Einkäufer die Katalogvorschauen nach dem Namen Sophie Reyer durchblättern, kommt er nicht zweistellig oft vor, wird es eine magere Saison mit verarmter Literatur. Der Stimmungsindex wird in diesem seltsamen Witz „Rayometer“ genannt.
In einem Buchhändlerwitz heißt es, wenn im Frühjahr und Herbst die Einkäufer die Katalogvorschauen nach dem Namen Sophie Reyer durchblättern, kommt er nicht zweistellig oft vor, wird es eine magere Saison mit verarmter Literatur. Der Stimmungsindex wird in diesem seltsamen Witz „Rayometer“ genannt.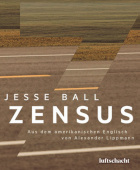 Warum ausgerechnet ich? – Quer durch die Jahrhunderte gibt es diese Schicksalsfrage, die das Individuum an eine anonyme Menge stellt, wenn es darum geht, einer besondere Anforderung zu entsprechen, etwas auszuhalten oder eine Barriere zu überwinden.
Warum ausgerechnet ich? – Quer durch die Jahrhunderte gibt es diese Schicksalsfrage, die das Individuum an eine anonyme Menge stellt, wenn es darum geht, einer besondere Anforderung zu entsprechen, etwas auszuhalten oder eine Barriere zu überwinden.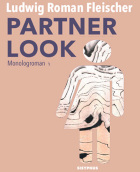 Die Weltliteratur, sagt man, ist sehr gerecht aufgebaut. Jedes Land darf einen besonderen Baustein dazu beitragen, und am Ende gibt es eine Fülle von Stoff, Erzähltechniken und überschäumenden Realismus.
Die Weltliteratur, sagt man, ist sehr gerecht aufgebaut. Jedes Land darf einen besonderen Baustein dazu beitragen, und am Ende gibt es eine Fülle von Stoff, Erzähltechniken und überschäumenden Realismus.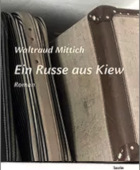 Merkt es eine Dichterin eigentlich, dass sie aus der Zeit gefallen ist? Und wenn ja, ist sie dann nicht schon wieder in der Zeit drin?
Merkt es eine Dichterin eigentlich, dass sie aus der Zeit gefallen ist? Und wenn ja, ist sie dann nicht schon wieder in der Zeit drin?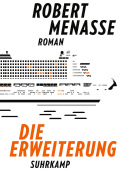 Der sogenannte Europa-Roman ist gleich zweimal definiert. Einmal als Roman, der sich um das politische Europa der Gegenwart kümmert, das seinen Sitz wie frühere Pfalzen überall am Kontinent hat, und zum zweiten als literarisches Genre.
Der sogenannte Europa-Roman ist gleich zweimal definiert. Einmal als Roman, der sich um das politische Europa der Gegenwart kümmert, das seinen Sitz wie frühere Pfalzen überall am Kontinent hat, und zum zweiten als literarisches Genre.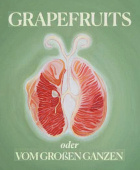 Einem Klumpen Lehm gleich wird der sogenannte Konzeptroman den Lesern auf einer Töpferscheibe angeboten, die sich beim Lesen zu drehen beginnt, sodass daraus ein persönlicher Golem geformt werden kann.
Einem Klumpen Lehm gleich wird der sogenannte Konzeptroman den Lesern auf einer Töpferscheibe angeboten, die sich beim Lesen zu drehen beginnt, sodass daraus ein persönlicher Golem geformt werden kann.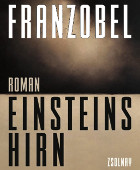 In Österreich kommen manche erst dann mit Bildung in Kontakt, wenn ihnen bei der Autopsie das Hirn entnommen und die Kopfhöhle mit der Kronenzeitung ausgestopft wird.
In Österreich kommen manche erst dann mit Bildung in Kontakt, wenn ihnen bei der Autopsie das Hirn entnommen und die Kopfhöhle mit der Kronenzeitung ausgestopft wird.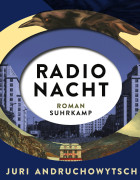 Durch den Krieg werden Vorkriegsromane zu Kriegsromanen. Autor und Publikum können das Rad der Literatur nicht zurückdrehen, beiden sind die Augen inzwischen anders aufgegangen als geplant. Und auch der Roman ist ein anderer geworden.
Durch den Krieg werden Vorkriegsromane zu Kriegsromanen. Autor und Publikum können das Rad der Literatur nicht zurückdrehen, beiden sind die Augen inzwischen anders aufgegangen als geplant. Und auch der Roman ist ein anderer geworden.