Erika Wimmer, Nellys Version der Geschichte
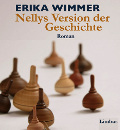 Es gibt keine absoluten Wahrheiten, alles, was wir für wahr halten sind letztlich mehr oder weniger geschickte Arrangements.
Es gibt keine absoluten Wahrheiten, alles, was wir für wahr halten sind letztlich mehr oder weniger geschickte Arrangements.
Erika Wimmer stellt in ihrem Roman über die „Ansicht eines Dichterinnenlebens“ bewusst Mehrdeutiges, Vages und Relatives in den Mittelpunkt des Erzählens. So genau und bohrend auch recherchiert wird, das Ergebnis ist immer nur eine gewisse Version einer Geschichte zu einer bestimmten Zeit.

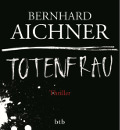 Ein kluges Buch wendet sich an die Intelligenz des Lesers und bietet so nebenbei seine Freundschaft an. Wenn das Buch als abgerissener Konsumartikel mit der Brechstange der Werbesemantik auftritt, wird man als Leser vorsichtig.
Ein kluges Buch wendet sich an die Intelligenz des Lesers und bietet so nebenbei seine Freundschaft an. Wenn das Buch als abgerissener Konsumartikel mit der Brechstange der Werbesemantik auftritt, wird man als Leser vorsichtig. Bücher über das österreichische Schul- und Bildungswesen haben meist eine Kreissäge eingebaut, mit der sie in schrillen Tönen das Sujet zerschneiden und keinen Stein auf dem anderen lassen.
Bücher über das österreichische Schul- und Bildungswesen haben meist eine Kreissäge eingebaut, mit der sie in schrillen Tönen das Sujet zerschneiden und keinen Stein auf dem anderen lassen. Für besonders abartige Realitätsvorfälle haben unsere Sinnesorgane Abwehrmechanismen entwickelt, damit wir möglichst unversehrt bleiben. In der Literatur gibt es freilich Arrangements von Geschichten, die an diese Grenze heran gehen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, „das will ich nicht wissen“, und die Neugierde uns dazu treibt, die Geschichte bis zur letzten Zeile auszuschlürfen.
Für besonders abartige Realitätsvorfälle haben unsere Sinnesorgane Abwehrmechanismen entwickelt, damit wir möglichst unversehrt bleiben. In der Literatur gibt es freilich Arrangements von Geschichten, die an diese Grenze heran gehen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, „das will ich nicht wissen“, und die Neugierde uns dazu treibt, die Geschichte bis zur letzten Zeile auszuschlürfen.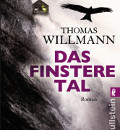 Das ist in der Literatur ganz selten, dass eine Tirol-Ikone vom Cover glänzt und der ganzen Welt zeigt, wie ein echter Tiroler drein schaut.
Das ist in der Literatur ganz selten, dass eine Tirol-Ikone vom Cover glänzt und der ganzen Welt zeigt, wie ein echter Tiroler drein schaut.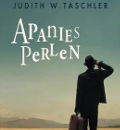 Am witzigsten wird die Literatur immer dann, wenn die Realität so kompakt ins Unwahrscheinliche verdichtet wird, dass man sie nur mehr mit Schmunzeln und Gelächter aushalten kann. Der von der Germanistik so geliebte Realismus kippt ins Sagenhafte, wenn sich auf jeder Seite eine neue Ungehörigkeit auftut.
Am witzigsten wird die Literatur immer dann, wenn die Realität so kompakt ins Unwahrscheinliche verdichtet wird, dass man sie nur mehr mit Schmunzeln und Gelächter aushalten kann. Der von der Germanistik so geliebte Realismus kippt ins Sagenhafte, wenn sich auf jeder Seite eine neue Ungehörigkeit auftut.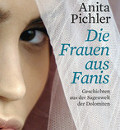 Die heftigste Literaturform ist das Fragment, die wesentlichen Geschichten lassen sich nur als Fragment erzählen, das Fragment ist vollkommen, weil es unvollendet ist.
Die heftigste Literaturform ist das Fragment, die wesentlichen Geschichten lassen sich nur als Fragment erzählen, das Fragment ist vollkommen, weil es unvollendet ist. Straßen werden als Verbindungskanäle zwischen Kulturen literarisch hoch gelobt, die Wirtschaft schätzt sie als Fundamente des Handels und das Kapital als Ort intensiven Investments, wenn man wieder einmal die Maschinen auffahren lässt.
Straßen werden als Verbindungskanäle zwischen Kulturen literarisch hoch gelobt, die Wirtschaft schätzt sie als Fundamente des Handels und das Kapital als Ort intensiven Investments, wenn man wieder einmal die Maschinen auffahren lässt.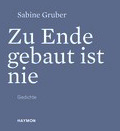 Lyrik ist nicht nur der Text, der irgendwie zu den Leserinnen durchdringt, sondern vor allem das Ambiente, die Darbietungsform, das Weiße zwischen den Zeilen, das Haptische zwischen den Fingern, der Klang, der beim Umblättern entsteht.
Lyrik ist nicht nur der Text, der irgendwie zu den Leserinnen durchdringt, sondern vor allem das Ambiente, die Darbietungsform, das Weiße zwischen den Zeilen, das Haptische zwischen den Fingern, der Klang, der beim Umblättern entsteht. Wenn eine frisch gegründete Institution mit der ersten markanten Arbeit an die Öffentlichkeit geht, so ist vor allem das erste Thema in seiner Programmatik von schlagendem Interesse. Im Falle des Archivs für Photographische Dokumentation ist es die Pustertalbahn, die als das Rückgrat des Fragmentes Osttirol in ihrer politischen, strategischen und kulturellen Auswirkung gezeigt wird.
Wenn eine frisch gegründete Institution mit der ersten markanten Arbeit an die Öffentlichkeit geht, so ist vor allem das erste Thema in seiner Programmatik von schlagendem Interesse. Im Falle des Archivs für Photographische Dokumentation ist es die Pustertalbahn, die als das Rückgrat des Fragmentes Osttirol in ihrer politischen, strategischen und kulturellen Auswirkung gezeigt wird.