Thomas Schafferer / Johanna Maria Egger / Daniel Furxer, Pitsch, Patsch, Putsch
 Was wie ein politischer Auszählreim klingt, ist ein poetisch-journalistisches Schreibprogramm der literarischen Connection „Die Schreibmaschinen“, die ihrerseits im Dachverband der Innsbrucker Literaturzeitschrift „Cognac und Biskotten“ untergebracht sind.
Was wie ein politischer Auszählreim klingt, ist ein poetisch-journalistisches Schreibprogramm der literarischen Connection „Die Schreibmaschinen“, die ihrerseits im Dachverband der Innsbrucker Literaturzeitschrift „Cognac und Biskotten“ untergebracht sind.
Die Schreibmaschinen treten lose in stets veränderter Form in den diversen Literaturzentren auf oder machen wie im Falle Budapest eine unscheinbare Stadt durch ihren Aufenthalt zu einem literarischen Ereignis.

 Manches um uns herum ist so permanent unauffällig anwesend wie der Blutdruck, dass wir es erst wahrnehmen, wenn wir und bewusst daran heranmachen.
Manches um uns herum ist so permanent unauffällig anwesend wie der Blutdruck, dass wir es erst wahrnehmen, wenn wir und bewusst daran heranmachen. Tut weniger saufen und statt dessen mein Buch subskribieren, vielleicht gibt’s doch noch einen Rausch.
Tut weniger saufen und statt dessen mein Buch subskribieren, vielleicht gibt’s doch noch einen Rausch. „Vor die Wahl gestellt zwischen Kummer und Nichts, nehme ich den Kummer.“ (116)
„Vor die Wahl gestellt zwischen Kummer und Nichts, nehme ich den Kummer.“ (116) Im allgemeinen Gebrauch bedeutet „mörderisch“ neben dem tödlichen Aspekt auch eine zustimmende Übertreibung eines Sachverhaltes. So kann etwa ein Menü mörderisch gut sein, ein Politiker eine mörderische Aussage hinlegen oder ein Rennläufer eine mörderische Abfahrt hinunter flitzen.
Im allgemeinen Gebrauch bedeutet „mörderisch“ neben dem tödlichen Aspekt auch eine zustimmende Übertreibung eines Sachverhaltes. So kann etwa ein Menü mörderisch gut sein, ein Politiker eine mörderische Aussage hinlegen oder ein Rennläufer eine mörderische Abfahrt hinunter flitzen.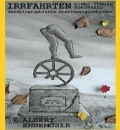 „Das Leben ist ein wilder Lauf zur Grube mit vielen selbst gebauten Hindernissen.“ (83)
„Das Leben ist ein wilder Lauf zur Grube mit vielen selbst gebauten Hindernissen.“ (83) Der Koch-Philosoph Peter Kubelka hat einmal in unvergesslicher Form behauptet, man merkt es einer Speise an, mit welcher liebevollen Energie sie kreiert worden ist. Ein Knödel lebt nach dieser Theorie von jeder einzelnen Umdrehung jener Hände, in welchen er gerollt worden ist.
Der Koch-Philosoph Peter Kubelka hat einmal in unvergesslicher Form behauptet, man merkt es einer Speise an, mit welcher liebevollen Energie sie kreiert worden ist. Ein Knödel lebt nach dieser Theorie von jeder einzelnen Umdrehung jener Hände, in welchen er gerollt worden ist. Manchmal kann das Infrage-Stellen eines einzigen Satzes ein ganzes Weltbild zum Kippen bringen. Die Behauptung „Kein Schluss geht nicht“, geht auf eine Katzengeschichte Margret Rettichs zurück und bringt damit quasi die gängige Erzähl-Theorie auf den Punkt.
Manchmal kann das Infrage-Stellen eines einzigen Satzes ein ganzes Weltbild zum Kippen bringen. Die Behauptung „Kein Schluss geht nicht“, geht auf eine Katzengeschichte Margret Rettichs zurück und bringt damit quasi die gängige Erzähl-Theorie auf den Punkt. Wo immer man im öffentlichen Raum mit diesem Buch unterwegs ist, man wird als Leser gnadenlos angestarrt nach dem Motto, was haben die Obdachlosen mit Nietzsche zu tun.
Wo immer man im öffentlichen Raum mit diesem Buch unterwegs ist, man wird als Leser gnadenlos angestarrt nach dem Motto, was haben die Obdachlosen mit Nietzsche zu tun.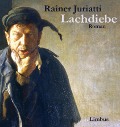 Üblicherweise leiden in der Literatur die Helden unter der Zeit, sie werden von ihr aufgefressen, verstoßen oder zur Strecke gebracht.
Üblicherweise leiden in der Literatur die Helden unter der Zeit, sie werden von ihr aufgefressen, verstoßen oder zur Strecke gebracht.