Manfred Grieger, Voll auf Strom
 „Zur weiteren Vorbereitung der Unternehmensgründung und des Achenseeprojekts konstituierte sich am 23. April 1924 in Wien in den Räumen der Allgemeinen Österreichi-schen Boden-Credit-Anstalt ein Interimskomitee der Tiroler Wasserkraftwerke AG (TI-WAG).“ (S. 39)
„Zur weiteren Vorbereitung der Unternehmensgründung und des Achenseeprojekts konstituierte sich am 23. April 1924 in Wien in den Räumen der Allgemeinen Österreichi-schen Boden-Credit-Anstalt ein Interimskomitee der Tiroler Wasserkraftwerke AG (TI-WAG).“ (S. 39)
Die Tiroler Elektrizitätswirtschaft stellt seit den 1920er Jahren neben dem Tourismus eine wich-tige Triebfeder für die ökonomische Entwicklung Tirols dar und nahm so eine nicht zu unter-schätzende Rolle im wirtschaftlichen Leben des Landes ein.

 Ein vielschichtiger Roman hat den Vorteil, dass man ihn nicht falsch lesen kann. Denn eine Komponente passt immer, und über diesen entgegenkommenden Weg öffnen sich bald auch die Seitenstränge und Querträger der Komposition.
Ein vielschichtiger Roman hat den Vorteil, dass man ihn nicht falsch lesen kann. Denn eine Komponente passt immer, und über diesen entgegenkommenden Weg öffnen sich bald auch die Seitenstränge und Querträger der Komposition.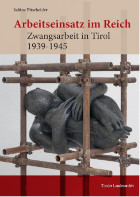 „Den maßgeblichen Rahmen, wer wie zu behandeln war, bot die »Rassenhierarchie«, wonach das NS-Regime Menschen je nach Herkunft oder Religion in bessere und schlechtere, wertvolle und »minderwertige« einteilte.“ (S. 51)
„Den maßgeblichen Rahmen, wer wie zu behandeln war, bot die »Rassenhierarchie«, wonach das NS-Regime Menschen je nach Herkunft oder Religion in bessere und schlechtere, wertvolle und »minderwertige« einteilte.“ (S. 51) Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann.
Wenn die Stimmung im Land wieder einmal bedrückend wird, hilft manchmal ein Roman nach der Vorlage von Kleists Michael Kohlhaas, damit man sich mit dem Helden identifizieren, mit ihm kämpfen und mit ihm in Würde untergehen kann. Mit fünfzig hält ein sensibler Künstler meist öffentlich inne, um sein Werkeln zu reflektieren und seinem Publikum fallweise darzulegen, welche Entwicklungskurven seine Kunst genommen hat. Denn in der Kunst ist nichts geradlinig.
Mit fünfzig hält ein sensibler Künstler meist öffentlich inne, um sein Werkeln zu reflektieren und seinem Publikum fallweise darzulegen, welche Entwicklungskurven seine Kunst genommen hat. Denn in der Kunst ist nichts geradlinig. Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur.
Widerstand, Eigenart und Selbstbewusstsein der Südtiroler resultieren aus dem täglichen Überlebenskampf des Individuums inmitten der Massen. Josef Oberhollenzer zeigt in seinen Romanen immer wieder, dass es sich lohnt, ein Individuum zu sein. Denn es sind immer die Massen, die einsam sind, ‒ die Einzelgänger sind nämlich umkost von Kunst und Literatur. In der naiven Malerei sind die Grenzen zwischen Handwerk, Kunst, Autodidaktik und Akademie aufgehoben. Was als schlichte künstlerische Äußerung erscheint, ist in Wirklichkeit eine Handhabung der Realität unter dem Filter der Lebenserfahrung.
In der naiven Malerei sind die Grenzen zwischen Handwerk, Kunst, Autodidaktik und Akademie aufgehoben. Was als schlichte künstlerische Äußerung erscheint, ist in Wirklichkeit eine Handhabung der Realität unter dem Filter der Lebenserfahrung. Wenn man ein gesamtes Leben als Biographie in einem Buch unterbringen kann, so müsste es auch möglich sein, einen gesamten Stadtteil zu einem Buch zu verdichten, indem man einen begeisterten Bewohner darin herumgeistern lasst.
Wenn man ein gesamtes Leben als Biographie in einem Buch unterbringen kann, so müsste es auch möglich sein, einen gesamten Stadtteil zu einem Buch zu verdichten, indem man einen begeisterten Bewohner darin herumgeistern lasst. Wenn eine zarte Pflanze verletzt wird, wächst sie geduckt und verwundet auf. – Diese Baumschulweisheit gilt erst recht für Kinder, die in Aufzucht-Institutionen rabiater Systeme unter die Räder gekommen sind. Margit Weiß erzählt vom zehnjährigen Hans Dakosta, der 1954 vom Unterricht abgeholt wird und ohne Wissen seiner Eltern in eine Erziehungsanstalt gesteckt wird. „Was man nicht sieht, ist doch da!“ – Diese Erfahrung, die der junge Held im Erziehungssystem der Tiroler Nachkriegszeit machen muss, wird zu einem leidvollen Leitsatz, mit dem der Held sich über Wasser zu halten versucht. Dabei ist auch diese Fügung schon wieder heimtückisch, denn im großen Schlafsaal der Anstalt spielt Bettnässen eine gewichtige Rolle.
Wenn eine zarte Pflanze verletzt wird, wächst sie geduckt und verwundet auf. – Diese Baumschulweisheit gilt erst recht für Kinder, die in Aufzucht-Institutionen rabiater Systeme unter die Räder gekommen sind. Margit Weiß erzählt vom zehnjährigen Hans Dakosta, der 1954 vom Unterricht abgeholt wird und ohne Wissen seiner Eltern in eine Erziehungsanstalt gesteckt wird. „Was man nicht sieht, ist doch da!“ – Diese Erfahrung, die der junge Held im Erziehungssystem der Tiroler Nachkriegszeit machen muss, wird zu einem leidvollen Leitsatz, mit dem der Held sich über Wasser zu halten versucht. Dabei ist auch diese Fügung schon wieder heimtückisch, denn im großen Schlafsaal der Anstalt spielt Bettnässen eine gewichtige Rolle. Der sogenannte Lebensstil lässt sich oft kunstvoll zu einem Stillleben zusammenfassen, das sich als Bild oder Gedicht präsentiert. Andreas Pargger unternimmt im Lyrikband „Wie wir leben wollen“ gut fünfzig Anläufe, um sogenannte Lebensentwürfe auszuprobieren. Dabei poppen die Gedichte als Momentaufnahmen auf, in denen sich ein dramatischer Prozess ablesen lässt wie bei einem Poster, das einen besonderen Gestus einer Rolle in den Vordergrund stellt.
Der sogenannte Lebensstil lässt sich oft kunstvoll zu einem Stillleben zusammenfassen, das sich als Bild oder Gedicht präsentiert. Andreas Pargger unternimmt im Lyrikband „Wie wir leben wollen“ gut fünfzig Anläufe, um sogenannte Lebensentwürfe auszuprobieren. Dabei poppen die Gedichte als Momentaufnahmen auf, in denen sich ein dramatischer Prozess ablesen lässt wie bei einem Poster, das einen besonderen Gestus einer Rolle in den Vordergrund stellt.