Michael Stark, Weltfremd
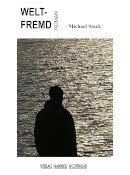 Nach dem Koma ist nur eines gewiss: Alles, was bei den Sinnesorganen hereinschaut, ist etwas Fremdes. Zwischen der Welt und dem Individuum fremdelt es.
Nach dem Koma ist nur eines gewiss: Alles, was bei den Sinnesorganen hereinschaut, ist etwas Fremdes. Zwischen der Welt und dem Individuum fremdelt es.
Michael Stark erzählt aus der Innensicht eines Helden, der eigentlich keine Sprache, keine Erinnerung und keinen Realitätssinn hat. Als Ich-Erzähler, der offensichtlich als Drehbuchautor früher ganze Welten erfinden und erschreiben konnte, ist er jetzt darauf angewiesen, seinen eigenen Zustand in irgendwas Sprachliches zu fassen, das vorläufig nur als sinnlose Wortpartikel durch seinen Kopf geistert.

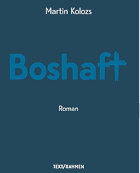 Das literarische Bermudadreieck für para-normale Fiktion ist irgendwo zwischen Edgar Allen Poe (Die Sphinx), Andre Gide (Die Verliese des Vatikan) und Ray Bradbury (Fahrenheit 451) angesiedelt.
Das literarische Bermudadreieck für para-normale Fiktion ist irgendwo zwischen Edgar Allen Poe (Die Sphinx), Andre Gide (Die Verliese des Vatikan) und Ray Bradbury (Fahrenheit 451) angesiedelt.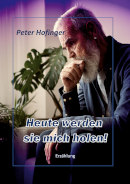 Die Befürchtung, geholt zu werden, überfällt in Romanen oft jene Helden, die am Ende sind. Bei Norbert Gstrein etwa wird im „Einer“ der sprachgestörte Jakob abgeholt, als er mit dem Dorfleben nicht zurecht kommt, in Texten nach der Machtübernahme der Nazis müssen Andersdenkende oft befürchten, geholt zu werden.
Die Befürchtung, geholt zu werden, überfällt in Romanen oft jene Helden, die am Ende sind. Bei Norbert Gstrein etwa wird im „Einer“ der sprachgestörte Jakob abgeholt, als er mit dem Dorfleben nicht zurecht kommt, in Texten nach der Machtübernahme der Nazis müssen Andersdenkende oft befürchten, geholt zu werden. Hans schlägt einen Pfosten ins Erdreich und setzt einen kulturellen Claim in die Landschaft. Er ist jetzt eingemieteter Häuslbauer im Speckgürtel und hat sich erfolgreich einen Flecken Sprache, Gesinnung und Lebenssinn durch Umzäunung gesichert.
Hans schlägt einen Pfosten ins Erdreich und setzt einen kulturellen Claim in die Landschaft. Er ist jetzt eingemieteter Häuslbauer im Speckgürtel und hat sich erfolgreich einen Flecken Sprache, Gesinnung und Lebenssinn durch Umzäunung gesichert. Biographien verlaufen selten geradlinig, an ihren krummen Windungen lagern sich meist unverwechselbare Begebenheiten ab. Die daraus wachsenden Shortstorys dienen in der Literatur als unverwechselbare Marker eines Lebens, ähnlich wie es für die Forensik die Fingerabdrücke sind.
Biographien verlaufen selten geradlinig, an ihren krummen Windungen lagern sich meist unverwechselbare Begebenheiten ab. Die daraus wachsenden Shortstorys dienen in der Literatur als unverwechselbare Marker eines Lebens, ähnlich wie es für die Forensik die Fingerabdrücke sind.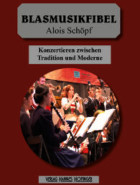 In der Medienkunde kursiert der sorgfältige Witz, wonach man zur App früher Fibel gesagt habe. Die Blasmusikfibel könnte man somit als nützliche App verwenden, um etwas über angewandte Hörkunst, Trachtenjoppe als soziologischen Filz und heißer Luft als Tonträger zu erfahren. Alle diese Erkenntnisfelder stecken nämlich im Phänomen Blasmusik.
In der Medienkunde kursiert der sorgfältige Witz, wonach man zur App früher Fibel gesagt habe. Die Blasmusikfibel könnte man somit als nützliche App verwenden, um etwas über angewandte Hörkunst, Trachtenjoppe als soziologischen Filz und heißer Luft als Tonträger zu erfahren. Alle diese Erkenntnisfelder stecken nämlich im Phänomen Blasmusik. Lyrik ist niemals eine Gebrauchsanweisung für etwas Bestimmtes, aber sie hilft, den Gebrauch der Wörter zu überdenken.
Lyrik ist niemals eine Gebrauchsanweisung für etwas Bestimmtes, aber sie hilft, den Gebrauch der Wörter zu überdenken. Wie ein Fisch ständig Wasser im Mund hat, um zu überleben, hat der Mensch am Lande Brot im Mund, und wenn um das tägliche Brot gekämpft wird, entsteht das Blutbrot.
Wie ein Fisch ständig Wasser im Mund hat, um zu überleben, hat der Mensch am Lande Brot im Mund, und wenn um das tägliche Brot gekämpft wird, entsteht das Blutbrot.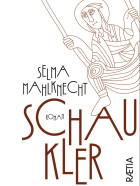 In der Prokulus-Kirche bei Naturns sitzt eine Figur auf einem gemalten Seil und schaukelt. Sie macht das so kühn und jenseits aller physikalischen Gepflogenheiten, dass die Menschen ihre Reise abbrechen und nachschauen, was es mit diesem Fresko aus alter Zeit auf sich hat. – Ist es überhaupt Kunst, was es da zu bestaunen gilt? Ein Kind sagt dazu verblüffend klar: Es ist ein Engel!
In der Prokulus-Kirche bei Naturns sitzt eine Figur auf einem gemalten Seil und schaukelt. Sie macht das so kühn und jenseits aller physikalischen Gepflogenheiten, dass die Menschen ihre Reise abbrechen und nachschauen, was es mit diesem Fresko aus alter Zeit auf sich hat. – Ist es überhaupt Kunst, was es da zu bestaunen gilt? Ein Kind sagt dazu verblüffend klar: Es ist ein Engel! Im Jahr 1951 sitzt eine Mutter in St. Johann vor einem leeren Papierhaufen und beginnt mit dem Aufschreiben von Erinnerungen für ihren Sohn. Die Schreiberin ist Marie Theres Foidl vom Lacknerhof. Sie ist aus Deutschland zugezogen und will ihrem Sohn erklären, dass man auch eine interessante Lebensgeschichte haben kann, wenn man nicht aus Tirol stammt.
Im Jahr 1951 sitzt eine Mutter in St. Johann vor einem leeren Papierhaufen und beginnt mit dem Aufschreiben von Erinnerungen für ihren Sohn. Die Schreiberin ist Marie Theres Foidl vom Lacknerhof. Sie ist aus Deutschland zugezogen und will ihrem Sohn erklären, dass man auch eine interessante Lebensgeschichte haben kann, wenn man nicht aus Tirol stammt.