Ulrike Kotzina, Verschwunden
 Was passiert eigentlich, wenn jemand, der das Verschwinden von Personen und Dingen bemerkt, selbst verschwindet?
Was passiert eigentlich, wenn jemand, der das Verschwinden von Personen und Dingen bemerkt, selbst verschwindet?
Ulrike Kotzina stellt in ihrem Roman „Verschwunden“ eine fertige Idylle vor, die sich allmählich auflöst und verschwindet. In sechs Kapiteln, die immer länger und kälter werden, löst sich eine Bilderbuchszenerie in Luft auf.

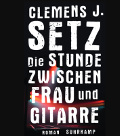 Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.
Kluge Titel evozieren die ganze Welt durch einen idealen Sehschlitz. Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist vielleicht ein Stillleben, das zu einem Wimmelbild ausgeufert ist.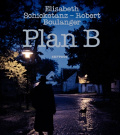 Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen.
Das Digitale kämpft gegen das Animalische und ist vielleicht identisch damit! Wer einmal ein File um diesen Kampf hat verschicken wollen, kennt das Gefühl, plötzlich am Präsentierteller eines Geheimdienstes zu liegen. In der guten alten Pop-Musik gibt es Heroen, Götter, Glitzer, Fans und Anbetungen wie in einer handfesten Religion. Die Mythen des auftretenden Pop-Personals sind ähnlich gestrickt wie Schöpfungsberichte oder Sagen des klassischen Altertums.
In der guten alten Pop-Musik gibt es Heroen, Götter, Glitzer, Fans und Anbetungen wie in einer handfesten Religion. Die Mythen des auftretenden Pop-Personals sind ähnlich gestrickt wie Schöpfungsberichte oder Sagen des klassischen Altertums.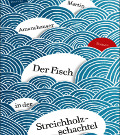 Um eine Gesellschaft so halbwegs allumfassend und gerecht beschreiben zu können, bedarf es eines außenliegenden Erzählstandpunktes, der ein Minimum an Überblick verspricht.
Um eine Gesellschaft so halbwegs allumfassend und gerecht beschreiben zu können, bedarf es eines außenliegenden Erzählstandpunktes, der ein Minimum an Überblick verspricht.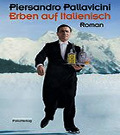 Spätestens seit der Komödie Scheidung auf Italienisch hat das Qualitätsmerkmal „italienisch“ etwas von pfiffig, pragmatisch und alltagskonform. Erben auf Italienisch ist also ein Vorgang, bei dem die Beteiligten klug auf den eigenen Vorteil achten.
Spätestens seit der Komödie Scheidung auf Italienisch hat das Qualitätsmerkmal „italienisch“ etwas von pfiffig, pragmatisch und alltagskonform. Erben auf Italienisch ist also ein Vorgang, bei dem die Beteiligten klug auf den eigenen Vorteil achten. Müde Schülerinnen, Lehrerinnen und Bibliothekarinnen träumen davon, dass sie etwas gelesen haben, ehe sie eingeschlafen sind, ohne dass sie etwas gelesen haben.
Müde Schülerinnen, Lehrerinnen und Bibliothekarinnen träumen davon, dass sie etwas gelesen haben, ehe sie eingeschlafen sind, ohne dass sie etwas gelesen haben. Was mag da Aufregendes herauskommen, wenn in Tübingen eine Novelle gedruckt wird, worin zwanzig Jahre nach der Matura sich Lieblingslehrer und Lieblingsschüler treffen und beide als Germanisten unterwegs sind?
Was mag da Aufregendes herauskommen, wenn in Tübingen eine Novelle gedruckt wird, worin zwanzig Jahre nach der Matura sich Lieblingslehrer und Lieblingsschüler treffen und beide als Germanisten unterwegs sind?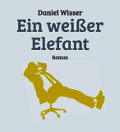 Romane aus der Arbeitswelt sind im Idealfall grotesk, um so das Ungerechte, Grausame und Sinnlose mit einem Restnutzen an Lust auszustatten.
Romane aus der Arbeitswelt sind im Idealfall grotesk, um so das Ungerechte, Grausame und Sinnlose mit einem Restnutzen an Lust auszustatten. Im Poetry Slam ist zwar jeden Tag die Hölle los und man weiß nie, wie der Abend ausgeht, die Heldinnen und Helden freilich reisen meist mit einer persönlichen Lyrik-Bibel an, die sie sich selbst geschrieben haben.
Im Poetry Slam ist zwar jeden Tag die Hölle los und man weiß nie, wie der Abend ausgeht, die Heldinnen und Helden freilich reisen meist mit einer persönlichen Lyrik-Bibel an, die sie sich selbst geschrieben haben.