Wolfgang Böhm, Zwischen Brüdern
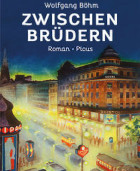 Hat es einen Sinn, eine Geschichte zu erzählen, die vor hundert Jahren gespielt hat? – Ja, weil in der Literatur ja nicht nur die Geschichte von damals, sondern plus hundert Jahre danach als Geschichte erzählt werden.
Hat es einen Sinn, eine Geschichte zu erzählen, die vor hundert Jahren gespielt hat? – Ja, weil in der Literatur ja nicht nur die Geschichte von damals, sondern plus hundert Jahre danach als Geschichte erzählt werden.
Wolfgang Böhm entwirft anhand eines Brüderpaars eine kleine atmosphärische Kulturgeschichte aus dem Wien der Zwischenkriegszeit des vorigen Jahrhunderts. Der Ich-Erzähler Viktor und sein Bruder Hans sind seinerzeit von Olmütz aus in den Ersten Weltkrieg geschickt worden. Boden- und orientierungslos landen sie in den 1920er Jahren im derangierten Wien, das gerade als geköpftes Haupt eines ehemaligen Kaiserreichs in Geographie und Geschichte herumliegt.

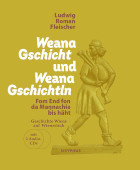 Das Buch von der Wiener Universal-Geschichte betritt man am besten, indem man wie durch einen akustischen Triumphbogen der Sprache mit zwei CDs hineinhüpft in den Text. „Weana Gschicht“ ist eine mündliche Angelegenheit, gleichsam öffentlich wie intim. Im Vorsatz sind die beiden güldenen CDs eingeklemmt. Der beigestellte Buchtext hat die Funktion, das Auge still zu halten, damit sich das Gehör konzentrieren kann. Wie eine Partitur zeigt der Text vor allem die Gliederung, die dem Jahrhundertwerk innewohnt.
Das Buch von der Wiener Universal-Geschichte betritt man am besten, indem man wie durch einen akustischen Triumphbogen der Sprache mit zwei CDs hineinhüpft in den Text. „Weana Gschicht“ ist eine mündliche Angelegenheit, gleichsam öffentlich wie intim. Im Vorsatz sind die beiden güldenen CDs eingeklemmt. Der beigestellte Buchtext hat die Funktion, das Auge still zu halten, damit sich das Gehör konzentrieren kann. Wie eine Partitur zeigt der Text vor allem die Gliederung, die dem Jahrhundertwerk innewohnt.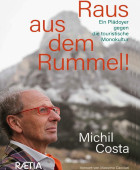 Tourismus funktioniert meist dort, wo zumindest eine der beteiligten Parteien das Denken eingestellt hat. In den Alpen haben sowohl Anbieter als auch Konsumenten die Reflexion während ihrer Tourismus-Performance eingestellt, weshalb er so prächtig funktioniert.
Tourismus funktioniert meist dort, wo zumindest eine der beteiligten Parteien das Denken eingestellt hat. In den Alpen haben sowohl Anbieter als auch Konsumenten die Reflexion während ihrer Tourismus-Performance eingestellt, weshalb er so prächtig funktioniert.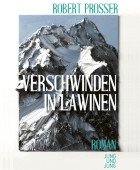 Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus davon abhängig, dass er auch von jenen mitgetragen wird, die ihm am liebsten aus dem Weg gehen. Ähnlich dem Sozialismus in der DDR ist der Tourismus in den Alpen eine Lebensform, die mit „IM“s im Dorfleben überwacht und eingefordert wird.
Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist der Tourismus davon abhängig, dass er auch von jenen mitgetragen wird, die ihm am liebsten aus dem Weg gehen. Ähnlich dem Sozialismus in der DDR ist der Tourismus in den Alpen eine Lebensform, die mit „IM“s im Dorfleben überwacht und eingefordert wird.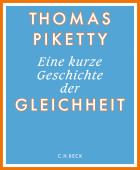 „Dieses Buch bietet eine vergleichende Geschichte der Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen Klassen in menschlichen Gesellschaften – oder vielmehr eine Geschichte der Gleichheit, gibt es doch eine langfristige historische Tendenz zu mehr sozialer, ökonomischer und politischer Gleichheit.“ (S. 13)
„Dieses Buch bietet eine vergleichende Geschichte der Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen Klassen in menschlichen Gesellschaften – oder vielmehr eine Geschichte der Gleichheit, gibt es doch eine langfristige historische Tendenz zu mehr sozialer, ökonomischer und politischer Gleichheit.“ (S. 13)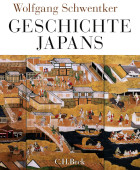 „Das vorliegende Buch […] betont das Spannungsverhältnis von «Außen» und «Innen» und stellt Japan damit zum einen stärker als andere Gesamtdarstellungen in den Kontext der asiatischen bzw. Weltgeschichte, und das auch dort, wo sich Japan explizit von Asien bzw. der Welt abwendet. Das hat Konsequenzen auch für die Epocheneinteilung. Sie ist einerseits konventioneller, weil sie den Wandel von einer Außen- zu einer Binnenperspektive mit Herrschaftswechseln in Verbindung bringt. Die politischen Wendemarken treten dadurch wieder deutlicher hervor.“ (S. 43)
„Das vorliegende Buch […] betont das Spannungsverhältnis von «Außen» und «Innen» und stellt Japan damit zum einen stärker als andere Gesamtdarstellungen in den Kontext der asiatischen bzw. Weltgeschichte, und das auch dort, wo sich Japan explizit von Asien bzw. der Welt abwendet. Das hat Konsequenzen auch für die Epocheneinteilung. Sie ist einerseits konventioneller, weil sie den Wandel von einer Außen- zu einer Binnenperspektive mit Herrschaftswechseln in Verbindung bringt. Die politischen Wendemarken treten dadurch wieder deutlicher hervor.“ (S. 43)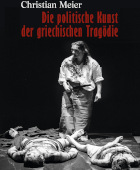 „Die griechischen Tragödien waren für die attischen Bürger bestimmt. Nicht für ein spezielles Theaterpublikum, sondern für die ganze Bürgerschaft der mächtigsten Stadt jener Welt. […] Es ist unbestreitbar, dass die attische Bürgerschaft im fünften Jahrhundert von ganz außerordentlicher Beschaffenheit war und sich in einer ganz außergewöhnlichen Lage befand. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte war es dazu gekommen, daß die breiten Schichten der Bürgerschaft regelmäßige, kräftige Mitsprache und schließlich den entscheidenden Anteil an der Politik erlangten.“ (S. 7)
„Die griechischen Tragödien waren für die attischen Bürger bestimmt. Nicht für ein spezielles Theaterpublikum, sondern für die ganze Bürgerschaft der mächtigsten Stadt jener Welt. […] Es ist unbestreitbar, dass die attische Bürgerschaft im fünften Jahrhundert von ganz außerordentlicher Beschaffenheit war und sich in einer ganz außergewöhnlichen Lage befand. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte war es dazu gekommen, daß die breiten Schichten der Bürgerschaft regelmäßige, kräftige Mitsprache und schließlich den entscheidenden Anteil an der Politik erlangten.“ (S. 7)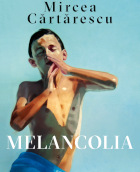 Es gibt rare Wörter, die eine Epoche, eine Kindheit, einen Kontinent oder eine Kunstrichtung beschreiben können. Melancholie ist das bekannteste davon.
Es gibt rare Wörter, die eine Epoche, eine Kindheit, einen Kontinent oder eine Kunstrichtung beschreiben können. Melancholie ist das bekannteste davon.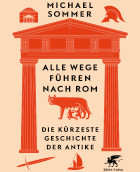 „Die folgenden Kapitel erzählen im Zeitraffer die Geschichte vom Zusammenbruch der bronzezeitlichen Großreiche um 1200 v. Chr. […] bis zum Ende des römischen Imperiums im Westen kurz vor 500 n. Chr. Sie wollen aber mehr sein als ein Durchritt durch griechische und römische Geschichte im Schweinsgalopp. Dieser Essay hat sein Ziel erreicht, wenn er das Bewusstsein schärft für die großen Bögen des Dramas, das sich um das antike Mittelmeerbecken entrollte, und wenn er zugleich in Erinnerung ruft, auf wie vielfältige Weise unsere Gegenwart mit der fernen Vergangenheit dieses einzigartigen Raumes verflochten ist.“ (S. 36)
„Die folgenden Kapitel erzählen im Zeitraffer die Geschichte vom Zusammenbruch der bronzezeitlichen Großreiche um 1200 v. Chr. […] bis zum Ende des römischen Imperiums im Westen kurz vor 500 n. Chr. Sie wollen aber mehr sein als ein Durchritt durch griechische und römische Geschichte im Schweinsgalopp. Dieser Essay hat sein Ziel erreicht, wenn er das Bewusstsein schärft für die großen Bögen des Dramas, das sich um das antike Mittelmeerbecken entrollte, und wenn er zugleich in Erinnerung ruft, auf wie vielfältige Weise unsere Gegenwart mit der fernen Vergangenheit dieses einzigartigen Raumes verflochten ist.“ (S. 36)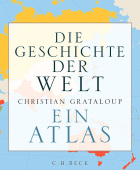 „Die Grundidee dieses – auch international erfolgreichen Weltatlas ist es nicht, so viele historische Details wie möglich in eine Karte zu packen, sondern die großen Linien der Globalgeschichte von den Anfängen der Menschheit bis heute mit Hilfe von Karten zu veranschaulichen.“ (Umschlag)
„Die Grundidee dieses – auch international erfolgreichen Weltatlas ist es nicht, so viele historische Details wie möglich in eine Karte zu packen, sondern die großen Linien der Globalgeschichte von den Anfängen der Menschheit bis heute mit Hilfe von Karten zu veranschaulichen.“ (Umschlag)