Michel Jean, Kukum
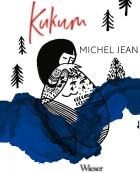 Wenn man die großen Erzählungen von Mutter Erde auf sich einwirken lässt, so sind die Geschichten oft wie das eigene Leben aufgebaut. Viele von uns haben eine unversehrte Kindheit, eine jähe Aufbruchsstimmung und das Desaster von Habgier und Wachstum erlebt, ehe wir jetzt alt und kaputt auf die Erde schauen und seufzen, dass wir deren Untergang gerade nicht mehr erleben werden.
Wenn man die großen Erzählungen von Mutter Erde auf sich einwirken lässt, so sind die Geschichten oft wie das eigene Leben aufgebaut. Viele von uns haben eine unversehrte Kindheit, eine jähe Aufbruchsstimmung und das Desaster von Habgier und Wachstum erlebt, ehe wir jetzt alt und kaputt auf die Erde schauen und seufzen, dass wir deren Untergang gerade nicht mehr erleben werden.
Die meisten unserer Jahrgänge haben das Lesen gelernt mit scheinbar unversehrten Geschichten von Robinson Crusoe oder Lederstrumpf. Wir Leser mussten alt werden, um nachzulesen, wie die Geschichte von der Eroberung und Verwüstung der Natur wirklich erzählt werden muss.

 Sagen sind das, was die Leute über die Jahrhunderte sagen. Diese witzige Definition erfreut zwar nicht das Fachpublikum, erklärt aber, dass Sagen nie fertig sind und in jeder Generation neu erzählt werden müssen. Und wenn es einmal keine Sagen mehr geben sollte, werden auch die Leute nichts mehr sagen, weil sie ausgestorben sind.
Sagen sind das, was die Leute über die Jahrhunderte sagen. Diese witzige Definition erfreut zwar nicht das Fachpublikum, erklärt aber, dass Sagen nie fertig sind und in jeder Generation neu erzählt werden müssen. Und wenn es einmal keine Sagen mehr geben sollte, werden auch die Leute nichts mehr sagen, weil sie ausgestorben sind.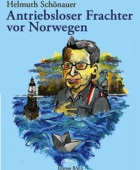 „In der Erinnerung ist etwas fixiert / indem eine gültige Fassung abgespeichert ist im Hirn / du denkst nicht mehr daran / dass es eine Alternative gegeben hätte damals / sondern alles ist unverrückbar gültig / wie ein Flugschreiber einer abgestürzten Maschine / der Flug mag zwar ungünstig ausgegangen sein / die Daten freilich sind fix“ (S. 16)
„In der Erinnerung ist etwas fixiert / indem eine gültige Fassung abgespeichert ist im Hirn / du denkst nicht mehr daran / dass es eine Alternative gegeben hätte damals / sondern alles ist unverrückbar gültig / wie ein Flugschreiber einer abgestürzten Maschine / der Flug mag zwar ungünstig ausgegangen sein / die Daten freilich sind fix“ (S. 16)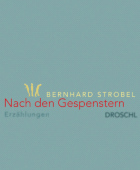 Wie bei Huhn und Ei ist auch die Urheberschaft der Gespenster diskutierbar. Suchen nun Gespenster die verschreckte Seele auf und setzen sich im Schreckzentrum nieder, oder treten zuerst Hirngespinste auf, die dann als abgeheilte Gespenster in die verschreckte Umwelt entlassen werden?
Wie bei Huhn und Ei ist auch die Urheberschaft der Gespenster diskutierbar. Suchen nun Gespenster die verschreckte Seele auf und setzen sich im Schreckzentrum nieder, oder treten zuerst Hirngespinste auf, die dann als abgeheilte Gespenster in die verschreckte Umwelt entlassen werden?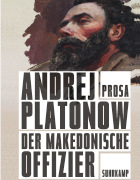 Die Erde entwickelt sich entweder zu einem reinen Kristall, der Wasser spendet, oder der Erdball verliert sich in einer giftigen Blase.
Die Erde entwickelt sich entweder zu einem reinen Kristall, der Wasser spendet, oder der Erdball verliert sich in einer giftigen Blase.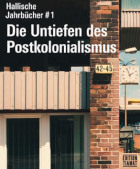 „Auch wenn solche antisemitischen und plumpen Angriffe auf die Singularität des Holocaust mittlerweile nicht mehr ganz so offen vorgetragen werden, hat in den vergangenen Jahren mit dem Siegeszug der Postkolonialen Studien eine weiche, aber nicht weniger problematische Form der Relativierung an den Universitäten und in den Feuilletons Einzug erhalten. Vertreter des Postkolonialismus sehen zwischen den Gräueltaten des deutschen bzw. europäischen Kolonialismus höchstens noch graduelle Unterschiede zum Holocaust und zeichnen eine fast direkte Linie von kolonialen Verbrechen nach Auschwitz.“ (S. 14)
„Auch wenn solche antisemitischen und plumpen Angriffe auf die Singularität des Holocaust mittlerweile nicht mehr ganz so offen vorgetragen werden, hat in den vergangenen Jahren mit dem Siegeszug der Postkolonialen Studien eine weiche, aber nicht weniger problematische Form der Relativierung an den Universitäten und in den Feuilletons Einzug erhalten. Vertreter des Postkolonialismus sehen zwischen den Gräueltaten des deutschen bzw. europäischen Kolonialismus höchstens noch graduelle Unterschiede zum Holocaust und zeichnen eine fast direkte Linie von kolonialen Verbrechen nach Auschwitz.“ (S. 14)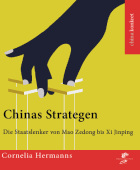 „Die chinesischen Kommunisten haben die Formel geprägt: Der Sozialismus chinesischer Prägung. Auf den folgenden Seiten soll der Sozialismus chinesischer Prägung für Nichtchinesen verständlich werden, China und sein origineller Kommunismus für Anfänger sozusagen, für Leserinnen und Leser, die nicht sinologisch vorgebildet sein müssen.“ (S. 9)
„Die chinesischen Kommunisten haben die Formel geprägt: Der Sozialismus chinesischer Prägung. Auf den folgenden Seiten soll der Sozialismus chinesischer Prägung für Nichtchinesen verständlich werden, China und sein origineller Kommunismus für Anfänger sozusagen, für Leserinnen und Leser, die nicht sinologisch vorgebildet sein müssen.“ (S. 9)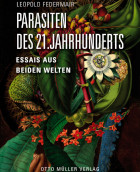 Parasiten sind Spezialisten, die im Kampf um Ressourcen eine Abkürzung nehmen. Oft wird dabei die Fresslinie Wirt-Zwischenwirt-Verbraucher eingehalten. Der Begriff Parasiten lässt sich aber in so gut wie allen Bedeutungsfeldern ausstreuen und anwenden. Wegen seiner Anwendung durch die Nazis im gesellschaftlichen Kontext hat er seine Unschuld verloren und gilt als Achtung!-Wort, bei dessen Anwendung es ,aufpassen‘ heißt.
Parasiten sind Spezialisten, die im Kampf um Ressourcen eine Abkürzung nehmen. Oft wird dabei die Fresslinie Wirt-Zwischenwirt-Verbraucher eingehalten. Der Begriff Parasiten lässt sich aber in so gut wie allen Bedeutungsfeldern ausstreuen und anwenden. Wegen seiner Anwendung durch die Nazis im gesellschaftlichen Kontext hat er seine Unschuld verloren und gilt als Achtung!-Wort, bei dessen Anwendung es ,aufpassen‘ heißt.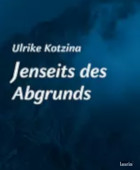 Totalitäre Systeme vereinnahmen die Literatur seit jeher durch Sanktionen, Marktbereinigungen und Ehrungen. Am Beispiel der DDR-Literatur lassen sich diese Maßnahmen aus heutiger Sicht nüchtern beschreiben. Es gibt freilich auch sublimere Formen des Totalitarismus, etwa wenn in einem Land nur mehr Bergbau, Digitalisierung oder Tourismus das Sagen haben. Diesen monumentalen Wirtschaftsformen ist eigen, dass sie in Sprache, Promotion und Leitbildern die Literatur kalt übernehmen und deren Bücher und Helden zu Werkzeugen des Regimes machen.
Totalitäre Systeme vereinnahmen die Literatur seit jeher durch Sanktionen, Marktbereinigungen und Ehrungen. Am Beispiel der DDR-Literatur lassen sich diese Maßnahmen aus heutiger Sicht nüchtern beschreiben. Es gibt freilich auch sublimere Formen des Totalitarismus, etwa wenn in einem Land nur mehr Bergbau, Digitalisierung oder Tourismus das Sagen haben. Diesen monumentalen Wirtschaftsformen ist eigen, dass sie in Sprache, Promotion und Leitbildern die Literatur kalt übernehmen und deren Bücher und Helden zu Werkzeugen des Regimes machen.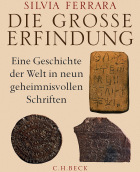 „Dieses Buch handelt weder von der griechischen Antike noch vom Alphabet, und es auch kein historischer Essay, sondern gewissermaßen eine Erzählung, die von einer Erfindung handelt: von der größten der Welt. Gewissermaßen, weil sie zwar einen Anfang hat und von einer abenteuerlichen Reise um die Welt handelt, ihr Ende aber erst noch geschrieben werden muss.“ (S. 9)
„Dieses Buch handelt weder von der griechischen Antike noch vom Alphabet, und es auch kein historischer Essay, sondern gewissermaßen eine Erzählung, die von einer Erfindung handelt: von der größten der Welt. Gewissermaßen, weil sie zwar einen Anfang hat und von einer abenteuerlichen Reise um die Welt handelt, ihr Ende aber erst noch geschrieben werden muss.“ (S. 9)