Vera Vieider, Leichtfüßig sein
 Leichtfüßig ist eine Lebenshaltung, die letztlich in alle Gegenden passt, es gibt sogar die Vorstellung, wonach etwas selbst leicht wird, wenn es leichtfüßig durchschritten wird.
Leichtfüßig ist eine Lebenshaltung, die letztlich in alle Gegenden passt, es gibt sogar die Vorstellung, wonach etwas selbst leicht wird, wenn es leichtfüßig durchschritten wird.
Vera Vieider weitet den Begriff der Leichtfüßigkeit auf alle Sinnesorgane aus, ein Glas kann leicht werden, wenn man es in die Hand nimmt, die Bilder offen, wenn man das Augenlicht daraufsetzt, und selbst die Haut kann die Verhältnisse leicht machen, wenn die Berührung gelingt.

 Bei jedem Lyrikband von Format bleibt einem als Leser beim ersten Anblättern etwas in Erinnerung, was diesen Band einmalig macht.
Bei jedem Lyrikband von Format bleibt einem als Leser beim ersten Anblättern etwas in Erinnerung, was diesen Band einmalig macht.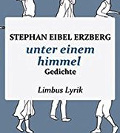 Die idealen Gedichte verklären den Alltag durch Aufklärung und können deshalb unauffällig und ungespreizt auftreten.
Die idealen Gedichte verklären den Alltag durch Aufklärung und können deshalb unauffällig und ungespreizt auftreten. Kampfschreie unterliegen keiner Rechtschreibregel, weshalb die Graffiti mit anderen Wörtern an den Mauern kleben als die Lehrsätze im Innern eines Geschichtsbuches.
Kampfschreie unterliegen keiner Rechtschreibregel, weshalb die Graffiti mit anderen Wörtern an den Mauern kleben als die Lehrsätze im Innern eines Geschichtsbuches. Beim historischen Schundheft der 1960er Jahre haben sich immer alle Beteiligten versteckt. Jetzt beim grandiosen Revival vom „Schundheft“ wird zwar ebenfalls die übliche Publikationsordnung auf den Kopf gestellt, die Autorinnen und Graphikerinnen verstecken sich aber nur lose hinter Initialen, die Herausgeber gehen in den Untergrund des Covers und der Titel verfehlt knapp den Villacher Fasching und propagiert „Lele“, was vermutlich in der Geheimsprache „Lesen!“ heißt.
Beim historischen Schundheft der 1960er Jahre haben sich immer alle Beteiligten versteckt. Jetzt beim grandiosen Revival vom „Schundheft“ wird zwar ebenfalls die übliche Publikationsordnung auf den Kopf gestellt, die Autorinnen und Graphikerinnen verstecken sich aber nur lose hinter Initialen, die Herausgeber gehen in den Untergrund des Covers und der Titel verfehlt knapp den Villacher Fasching und propagiert „Lele“, was vermutlich in der Geheimsprache „Lesen!“ heißt.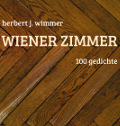 Allein wenn man über den Begriff „Wiener Zimmer“ zu rätseln beginnt, landet man mit einem Bauchfleck in den semantischen Überlegungen des Autors. Ist das Wiener Zimmer etwas wie die Wiener Melange, ist das Zimmer übriggeblieben aus Kuchl-Kabinett, ist es die räumliche Antwort auf das Frauenzimmer?
Allein wenn man über den Begriff „Wiener Zimmer“ zu rätseln beginnt, landet man mit einem Bauchfleck in den semantischen Überlegungen des Autors. Ist das Wiener Zimmer etwas wie die Wiener Melange, ist das Zimmer übriggeblieben aus Kuchl-Kabinett, ist es die räumliche Antwort auf das Frauenzimmer?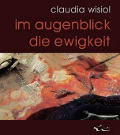 Gedichte sind oft extremen Zeitangaben ausgesetzt, zum einen handeln sie von der Flüchtigkeit des Augenblicks, zum anderen von der in Worten nicht zu fassenden Ewigkeit.
Gedichte sind oft extremen Zeitangaben ausgesetzt, zum einen handeln sie von der Flüchtigkeit des Augenblicks, zum anderen von der in Worten nicht zu fassenden Ewigkeit. In der guten Lyrik ist nicht nur die Schwerkraft als solche aufgehoben, im lyrischen Kraftfeld verlieren die Wörter oft auch ihre ursprüngliche Bedeutung und legen sich neue semantische Flügel zu.
In der guten Lyrik ist nicht nur die Schwerkraft als solche aufgehoben, im lyrischen Kraftfeld verlieren die Wörter oft auch ihre ursprüngliche Bedeutung und legen sich neue semantische Flügel zu. Es gibt in der österreichischen Poesie eine konsequente Richtung, die politisch-poetische Vorgänge eines kleinen Landes mit der Ästhetik von Unbestechlichkeit verbindet.
Es gibt in der österreichischen Poesie eine konsequente Richtung, die politisch-poetische Vorgänge eines kleinen Landes mit der Ästhetik von Unbestechlichkeit verbindet.  Irgendwo zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft sind die Tagträume zu Hause, die sich nicht greifen lassen, höchstens umrunden.
Irgendwo zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft sind die Tagträume zu Hause, die sich nicht greifen lassen, höchstens umrunden.