Tor Ulven, Das allgemein Unmenschliche
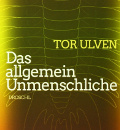 Die Bilder, die wir Leser uns von einem Land machen, gehen oft auf ein einziges Buch oder die Schreibweise einer einzigen Autorin zurück. Dabei entpuppt sich diese reduzierte Sichtweise als wahr und gerecht zugleich.
Die Bilder, die wir Leser uns von einem Land machen, gehen oft auf ein einziges Buch oder die Schreibweise einer einzigen Autorin zurück. Dabei entpuppt sich diese reduzierte Sichtweise als wahr und gerecht zugleich.
Im Falle von Norwegen denkt man unwillkürlich an Tor Ulven, der mit seinen ins Unterbewusstsein einschießenden Prosazellen etwas evoziert, was wir mit Norwegen, Blockhütte, Psyche und Ibsen in Verbindung bringen.

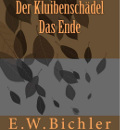 Wie sich die sogenannte Freiheit in einer straff geführten Gesellschaft anfühlt, kann am besten jemand erklären, der gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen worden ist.
Wie sich die sogenannte Freiheit in einer straff geführten Gesellschaft anfühlt, kann am besten jemand erklären, der gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Wundersame Geschichten, die in ihrem Verlaufe die Konsistenz der Glaubwürdigkeit wechseln, tun gut daran, handfest in den Händen der Leserschaft zu liegen und nicht als Fließtext aus der Cloud zu tröpfeln. Das ist auch der Grund, warum Martin Kolozs als Leiter des Kyrene Verlags dieses romantische Hauptwerk in eine bibliophile Ausstattung gegossen hat, gilt doch der romantische Adelbert von Chamisso als geheimer Heiliger für Phantasie und Standfestigkeit in einer bodenlosen Umgebung.
Wundersame Geschichten, die in ihrem Verlaufe die Konsistenz der Glaubwürdigkeit wechseln, tun gut daran, handfest in den Händen der Leserschaft zu liegen und nicht als Fließtext aus der Cloud zu tröpfeln. Das ist auch der Grund, warum Martin Kolozs als Leiter des Kyrene Verlags dieses romantische Hauptwerk in eine bibliophile Ausstattung gegossen hat, gilt doch der romantische Adelbert von Chamisso als geheimer Heiliger für Phantasie und Standfestigkeit in einer bodenlosen Umgebung.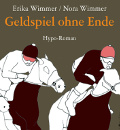 Gute Romane können sich einen Luxus leisten, der im Alltagsleben tabu ist: Die Wahrheit augenzwinkernd auszusprechen. „Geld ist genauso wichtig wie alles andere auf der Welt!“ (43) Wer geht als Leser nicht vor so einem Satz sofort bewundernd in die Knie.
Gute Romane können sich einen Luxus leisten, der im Alltagsleben tabu ist: Die Wahrheit augenzwinkernd auszusprechen. „Geld ist genauso wichtig wie alles andere auf der Welt!“ (43) Wer geht als Leser nicht vor so einem Satz sofort bewundernd in die Knie.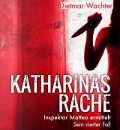 Inspektor Matteo ist einer der seltenen Ermittler im Krimi-Genre, die gerne ihre Arbeit tun, mit der Bevölkerung in positiver Verbindung stehen und den Grant zuerst an sich selber auslassen, ehe sie ihn anderen überkübeln. So gesehen freut man sich bei Matteo auf jeden Fall, denn auch wenn es um Mord und Totschlag geht, geht es immer auch um ein zivilisiertes Zusammenleben in der kleinen Gebirgsstadt Landstein.
Inspektor Matteo ist einer der seltenen Ermittler im Krimi-Genre, die gerne ihre Arbeit tun, mit der Bevölkerung in positiver Verbindung stehen und den Grant zuerst an sich selber auslassen, ehe sie ihn anderen überkübeln. So gesehen freut man sich bei Matteo auf jeden Fall, denn auch wenn es um Mord und Totschlag geht, geht es immer auch um ein zivilisiertes Zusammenleben in der kleinen Gebirgsstadt Landstein. Ein Leitsystem, das den Verleiteten nicht klar ist, führt diese in die Irre.
Ein Leitsystem, das den Verleiteten nicht klar ist, führt diese in die Irre. Für die Aufnahme in den literarischen Klassiker-Kreis braucht es zwei Voraussetzungen: Das Werk muss für Lehrer, Schüler und das Schulwesen gut aufbereitet sein und das Werk muss für die Leserschaft griffbereit und zugänglich sein. Beides ist bei Anita Pichler momentan der Fall, wie im Nachwort stolz vermerkt wird.
Für die Aufnahme in den literarischen Klassiker-Kreis braucht es zwei Voraussetzungen: Das Werk muss für Lehrer, Schüler und das Schulwesen gut aufbereitet sein und das Werk muss für die Leserschaft griffbereit und zugänglich sein. Beides ist bei Anita Pichler momentan der Fall, wie im Nachwort stolz vermerkt wird. Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend.
Jedes Buch löst in der Leserschaft Reaktionen aus, aber darüber hinaus ergibt sich auch ein Wechselspiel zwischen Leseambiente und Lektüre. Ein Buch über das Sterben wirkt in einem Umfeld voller Apps wischender Kids und in Krimis blätternden Bobos geradezu elementar herausragend.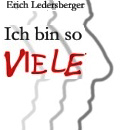 In einer Gesellschaft, wo das Vermehren von Kapital als das Non-plus-Ultra des Lebensglückes gilt, versuchen es einige auch mit dem Vermehren der eigenen Identitäten.
In einer Gesellschaft, wo das Vermehren von Kapital als das Non-plus-Ultra des Lebensglückes gilt, versuchen es einige auch mit dem Vermehren der eigenen Identitäten. In ausgeklügelten sozialen Systemen genügt die Nennung der Wohnadresse, um die darin agierenden Personen bereits genauestens zuordnen und aburteilen zu können.
In ausgeklügelten sozialen Systemen genügt die Nennung der Wohnadresse, um die darin agierenden Personen bereits genauestens zuordnen und aburteilen zu können.