Katja Alves, Mafalda mittendrin - Zwei Mäuse auf der Flucht
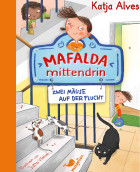 „»Cosimo, wo sind wir?« »Wir sitzen in einem miefigen Pappkarton auf einer Reise ins Ungewisse.« »Haha, sehr witzig.« »He, Claus! Was machst du?!« »Nichts … Uh, dieses Schaukeln ist ja nicht auszuhalten. Gleich kommt mein Frühstück hoch …« »UNTERSTEH DICH!«“ (S. 7)
„»Cosimo, wo sind wir?« »Wir sitzen in einem miefigen Pappkarton auf einer Reise ins Ungewisse.« »Haha, sehr witzig.« »He, Claus! Was machst du?!« »Nichts … Uh, dieses Schaukeln ist ja nicht auszuhalten. Gleich kommt mein Frühstück hoch …« »UNTERSTEH DICH!«“ (S. 7)
Mafaldas Beckmanns Bruder Flynn darf die beiden Wüstenrennmäusen Cosimo und Claus seines Freundes Henrik für eine Projektarbeit für die Schule beobachten. Malfalda ist ganz begeistert von den niedlichen Nagern und will sie unbedingt ihrer besten Freundin Selin zeigen, was Henrik rigoros ablehnt, bis er für den Besuch der Skate-Academy jemanden braucht, der sich um seine beiden Mäuse kümmert. Keine Frage, dass Mafalda diese Gelegenheit beim Schopf packt.

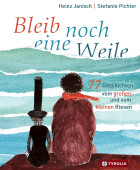 „Eines Abends beschloss ich 77 Geschichten zu schreiben. Die Zahl gefiel mir einfach. So machte ich mich an die Arbeit. Ich wollte, dass kleine und große Riesen, Zauberer und Elfen, Katzen und Menschen darin vorkommen. Ich wollte, dass die Magie nicht zu kurz kommt.“ (S. 5)
„Eines Abends beschloss ich 77 Geschichten zu schreiben. Die Zahl gefiel mir einfach. So machte ich mich an die Arbeit. Ich wollte, dass kleine und große Riesen, Zauberer und Elfen, Katzen und Menschen darin vorkommen. Ich wollte, dass die Magie nicht zu kurz kommt.“ (S. 5)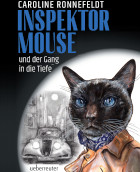 „»Was geschieht, wenn das Geld nicht wieder auftaucht und alles, wirklich alles verloren ist?« »Schon weil der Gegner der Schwarze Ole ist«, erwiderte Mouse, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, »gedenke ich dieses Spiel zu gewinnen.« Unter diesem vorläufigen und in den meisten Köpfen noch lange nachhallenden Schlusswort beendete die Lichtregie des Zufalls ahnungsvoll die Beleuchtung des Helden. Draußen musste sich eine Wolke vor die Sonne geschoben haben, was möglicherweise nichts Gutes verhieß.“ (S. 61)
„»Was geschieht, wenn das Geld nicht wieder auftaucht und alles, wirklich alles verloren ist?« »Schon weil der Gegner der Schwarze Ole ist«, erwiderte Mouse, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, »gedenke ich dieses Spiel zu gewinnen.« Unter diesem vorläufigen und in den meisten Köpfen noch lange nachhallenden Schlusswort beendete die Lichtregie des Zufalls ahnungsvoll die Beleuchtung des Helden. Draußen musste sich eine Wolke vor die Sonne geschoben haben, was möglicherweise nichts Gutes verhieß.“ (S. 61)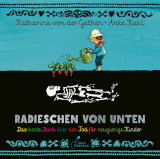 Dies ist ein Buch über das Sterben und den Tod. Ist Sterben schlimm? Kann es auch schön sein? Warum muss man überhaupt sterben? Was passiert dann? Und was ist, wenn meine liebsten Menschen sterben? Wäre es nicht viel toller, unsterblich zu sein? Niemand auf der Welt hat eine sichere Antwort auf solche Fragen. Menschen vor Hunderten und Tausenden von Jahren haben sie sich ganz genauso gestellt wie wir heute. Allein oder mit anderen darüber nachzudenken, kann etwas Licht ins Dunkel bringen. (S. 12)
Dies ist ein Buch über das Sterben und den Tod. Ist Sterben schlimm? Kann es auch schön sein? Warum muss man überhaupt sterben? Was passiert dann? Und was ist, wenn meine liebsten Menschen sterben? Wäre es nicht viel toller, unsterblich zu sein? Niemand auf der Welt hat eine sichere Antwort auf solche Fragen. Menschen vor Hunderten und Tausenden von Jahren haben sie sich ganz genauso gestellt wie wir heute. Allein oder mit anderen darüber nachzudenken, kann etwas Licht ins Dunkel bringen. (S. 12)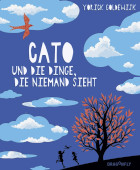 „Cato war zwölf, als ihr Vater sagte, dass sie endlich erwachsen werden sollte. Weil er nur selten etwas zu ihr sagte, war das für sie etwas Besonderes. Schade nur, dass er sich ausgerechnet etwas so Unsinniges ausgesucht hatte. Cato war ein Kind und brauchte noch lange nicht erwachsen zu werden. Und auf keinen Fall wollte sie jemals auf die Art erwachsen werden, wie er es war.“ (S. 9)
„Cato war zwölf, als ihr Vater sagte, dass sie endlich erwachsen werden sollte. Weil er nur selten etwas zu ihr sagte, war das für sie etwas Besonderes. Schade nur, dass er sich ausgerechnet etwas so Unsinniges ausgesucht hatte. Cato war ein Kind und brauchte noch lange nicht erwachsen zu werden. Und auf keinen Fall wollte sie jemals auf die Art erwachsen werden, wie er es war.“ (S. 9)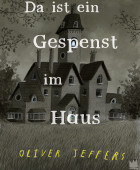 „Hallo. Komm doch bitte herein. Und willkommen! Ich hatte schon eine ganze Weile keinen Besuch mehr. Vielleicht kannst du mir helfen? Weißt du, ich habe gehört … dass hier Gespenster im Haus sind!“
„Hallo. Komm doch bitte herein. Und willkommen! Ich hatte schon eine ganze Weile keinen Besuch mehr. Vielleicht kannst du mir helfen? Weißt du, ich habe gehört … dass hier Gespenster im Haus sind!“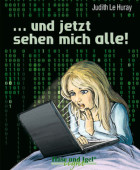 „Paula schlüpft erst kurz nach dem Klingeln ins Klassenzimmer. Ihre Augen sind knallrot und verheult. Ohne jemanden anzuschauen, verkrümelt sie sich auf ihren Platz. Da kommt auch schon Herr Mauz und legt sofort auf Englisch los. Nachdenklich schaut Tabea zu Paula. Ob deren Trauermine etwas mit der gefälschten Liebeserklärung zu tun hat?“ (S. 16)
„Paula schlüpft erst kurz nach dem Klingeln ins Klassenzimmer. Ihre Augen sind knallrot und verheult. Ohne jemanden anzuschauen, verkrümelt sie sich auf ihren Platz. Da kommt auch schon Herr Mauz und legt sofort auf Englisch los. Nachdenklich schaut Tabea zu Paula. Ob deren Trauermine etwas mit der gefälschten Liebeserklärung zu tun hat?“ (S. 16)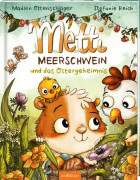 „Es war bitter-brrrr-kalt. Neben dem Bauernhof wuchsen schneeweiße Berge in den Himmel und kitzelten die winterlichen Wolken. Es gab Felder und Wälder und … WUUUSCHHHH! Was war das denn? Na, das war natürlich Metti Meerschwein. Schneeballschnell flitzte Metti aus dem Hasenstall. Dann machte sie einen Purzelbaum.“
„Es war bitter-brrrr-kalt. Neben dem Bauernhof wuchsen schneeweiße Berge in den Himmel und kitzelten die winterlichen Wolken. Es gab Felder und Wälder und … WUUUSCHHHH! Was war das denn? Na, das war natürlich Metti Meerschwein. Schneeballschnell flitzte Metti aus dem Hasenstall. Dann machte sie einen Purzelbaum.“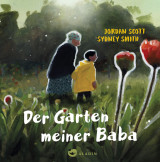 „Meine Baba wohnt in einem Hühnerhaus an einer großen Straße hinter einer Schwefelmühle, groß und spitz wie eine Pyramide, gelb wie eine Sonne, die nie schläft. Jeden Morgen fährt mein Papa mich da hin.“
„Meine Baba wohnt in einem Hühnerhaus an einer großen Straße hinter einer Schwefelmühle, groß und spitz wie eine Pyramide, gelb wie eine Sonne, die nie schläft. Jeden Morgen fährt mein Papa mich da hin.“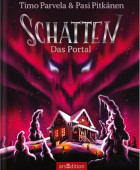 „»Das Land heißt Auroria. Früher, vor langer Zeit, gab es mehrere Portale. Die Gnome waren viel unterwegs, alle kamen und gingen, aber dann … der Krieg. Die Tore wurden geschlossen, nur eines blieb. Das haben wir gesucht. Isabella und ich.« (S. 11)
„»Das Land heißt Auroria. Früher, vor langer Zeit, gab es mehrere Portale. Die Gnome waren viel unterwegs, alle kamen und gingen, aber dann … der Krieg. Die Tore wurden geschlossen, nur eines blieb. Das haben wir gesucht. Isabella und ich.« (S. 11)