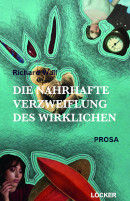 Wenn man über etwas trauert, das man vage als schön empfindet, gerade weil es vergangen ist, beschleicht einen manchmal das Gefühl von Melancholie. Diese kann sich als künstlerische Haltung bis hin zum Genre ausbilden, man denke etwa an Joseph Roth und seinen Abgesang auf die Monarchie, an Gerhard Fritschs Roman „Moos auf den Steinen“, oder Franz Tumlers „Der Schritt hinüber“.
Wenn man über etwas trauert, das man vage als schön empfindet, gerade weil es vergangen ist, beschleicht einen manchmal das Gefühl von Melancholie. Diese kann sich als künstlerische Haltung bis hin zum Genre ausbilden, man denke etwa an Joseph Roth und seinen Abgesang auf die Monarchie, an Gerhard Fritschs Roman „Moos auf den Steinen“, oder Franz Tumlers „Der Schritt hinüber“.
Richard Walls Grundbefinden als Bildender Künstler und Schriftsteller ist eine individuelle Nuance dieser Melancholie. Gespeist wird sie aus dem Erwachen der Sinne in den 1950er Jahren im Mühlviertel, als es noch eine Landschaft gibt und die Dinge und Gerätschaften einen Sinn haben, wenn man sie für die tägliche Lebensgestaltung in die Hand nimmt.
Dieses Gesamtbild aus Betrachten, in die Hand Nehmen und geordnetem Weglegen prägt Richard Wall, sodass er sein künstlerisches Gestalten auf dieses Stillleben rund um seine Kindheit bauen kann.
Seine wichtigste Aufgabe wird das Lesen der Landschaft, dabei wechselt er zwischen der Irischen Küste und dem Granit des Mühlviertels.
Zum größten Miss-Erlebnis wird die Erfahrung, dass Landschaft überall verschwindet und von urbaner Peripherie überwuchert wird. Selbst Ortswechsel bringen nicht viel, denn dieser Zeitgeist der Verwüstung frisst sich durch alle Höhenlagen in die ehemals überschaubare Natur. Was einem bleibt, ist Melancholie, oder wie es im Buchtitel heißt: „Die nahrhafte Verzweiflung des Wirklichen“.
Unter den drei Schwerpunkten Regionallandschaft, Weltlandschaft, Künstler als Granit-Findlinge gegen das Amorphe sind etwa 150 Texte aus den letzten zwanzig Jahren versammelt. Dabei werden die Tage jeweils frisch ausgerollt mit neuem Blick, wobei die Niederschrift überprüft, was wieder verschwunden ist über Nacht.
Ein Alter deutet die Wolken und das Licht, wenn man ihn zum Reden bringt, denn meistens bleibt er stumm und zieht seine Kreise rund ums Dorf, bis ihn wer anspricht. Aber niemand interessiert sich für die Geschichten, die als Wolkendrama aufgeführt werden, weil niemand mehr den Blick zum Himmel richtet. (15)
„Ich lese täglich in der Landschaft vor meinem Fenster.“ (19) An anderer Stelle lässt der Autor seinen wund getretenen Zeh mitsprechen, der ihm die Wanderungen des Vortags zum Vorwurf macht.
Die beiläufig aufgeschnappte Wortbildung „Saumagen“ lässt darüber nachdenken, wie all diese abgeerntete Landschaft in den Mägen der Haustiere landet, bis diese mittels eines Saumagens von den Menschen zu Festlichkeiten verzehrt werden.
Das Sinnieren über die Landschaft mündet zwangsläufig in Zumutungen, die überall ausgelegt sind. Die Obstbäume geschlägert, das Land verkommen, nicht bloß die Landschaft. Die Kunst als letzte Widerstandskraft wird zugemüllt mit Alltagsmaterialien und die „Häuselbauerkunst“ hat den öffentlichen Raum übernommen. (39)
„Eine Kunst, die sofort in den Strom des assimilierenden Kunstmarkts mündet, büßt ihre Zuständigkeit ein für jene Fragen, die uns unter den Nägeln brennen.“ (45)
Im Poem „Nahrhafte Verzweiflung“ liegen zwischen Klärschlamm und Klarsicht Nebelwände, dahinter ringt jemand um einen entscheidenden Begriff, der der Haarspalterei sehr nahe kommt. Wo ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt einer Argumentation, die vielleicht ins Leere geht? (50)
Zwischen Melancholie, Groteske und Verzweiflung ist jene Szene aus dem April 2018 angesiedelt, als der Autor Hahn und Hennen schlachten muss, weil die Nachbarschaft in Gestalt einer Vorstadtsiedlung angerückt ist. Das letzte Ei bekommt der Igel, das Federvieh fliegt nach der Köpfung eine Ehrenrunde für den Verzweifelten. „Den ganzen Vormittag lang lief ich umher wie verrückt und brachte nichts auf die Reihe.“ (56)
Aus der Abteilung „Randgebiete der Globalisierung“ sind ein paar Lücken beschrieben, die in der durchgetakteten Tourismuswelt jedes Jahr weniger werden. Texte aus Samos, Istrien, dem Maghreb oder Costa Rica wirken wie kleine Sauerstoffdepots, aus denen der Abgetauchte eine Portion „Mundvoll“ nimmt, ehe es wieder ab geht in die Flughäfen, Schlafplätze und Hotspots für billigen Souvenir-Kram, der für niemandem zum Überleben reicht.
Ein eigenes Kapitel ist dem Mäandern gewidmet, einem Begriff, der das Dahinfließen in Kunst, Geologie und Psyche beschreibt. Wo darf man sich als Künstler gehen lassen, ab wann wird Mäandern zur Kunst?
Ein kleines Depot an künstlerischen Porträts wird zum Abschluss des Bandes aus der Erinnerungswand gezogen. Meist sind es Künstler aus einer klandestinen Kunstwelt, die gewürdigt werden. Mit vielen hat der Autor Ausstellungen betrieben, mit andern fühlt er sich geistesverwandt, wie mit der in der Peripherie eingekeilten Christine Lavant oder dem in der Peripherie in Richtung Nichts verschollen gegangenen Bodo Hell.
In einer „unaufgeforderten Begründung“ kommentiert Richard Wall seine Kunst, sein Schreiben, sein Leben und sein Wirken mit den archaischen Worten: „Kein ausgefranster Kälberstrick, sondern die Reihe der Ahnen, die gerodet, gepflügt, gesät und geerntet, hielten mein Abnützen gebunden an die blut- und schweißgetränkte Rinde. // Hände wie Augen sind gefolgt den Möglichkeiten des Werkzeugs. / Hammerschläge, Beilwürfe, ein Hahnenschrei durch eine Luft aus Frost und Hitze. […] (179)
Richard Wall, Die nahrhafte Verzweiflung des Wirklichen. Prosa
Wien: Löcker Verlag 2025, 190 Seiten, 19,80 €, ISBN 978-3-99098-213-6
Weiterführende Links:
Löcker Verlag: Richard Wall, Die nahrhafte Verzweiflung des Wirklichen
Wikipedia: Richard Wall
Helmuth Schönauer, 09-06-2025
